Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt
Komponisten / Stücke S – Z
Dieter Schnebel: Zahlen mit (für) Münzen
Die Anregung zu diesem Stück verdanke ich der experimentellen Phantasie von Schülern. Während meiner Frankfurter Tätigkeit als Lehrer kam ich eines Tages in eine Klasse und hörte faszinierende Klänge: nämlich die von rollenden Münzen, die durch die Resonanz der stabilen Holztische noch gute Verstärkung und hübschen Nachhall erhielten. Viele Jahre später, als ich am Münchener Oskar-von-Miller-Gymnasium selbst eine Arbeitsgemeinschaft für neue Musik leitete, schrieb ich dafür dann dieses Stück, das mit allerlei Aktionen mit Geldstücken spielerisch arbeitet: Münzen rollen, setzen, schütteln, werfen u. a. Die Aktionen selbst sind entweder in den Einsätzen, oder im Tempo, oder im Rhythmus zeitlich geregelt; vor allem aber ist die Anzahl der Münzen, die sich jeweils im Spiel befinden, kompositorisch festgelegt – daher der Titel des Werkes. Indessen haben Aktionen mit Geldstücken auch eine eigene, womöglich drastische Symbolik. Auch solche ist bedacht, und der Titel mag also recht wörtlich verstanden werden: Zahlen mit Münzen.
Dieter Schnebel
Dieter Schnebel
Dieter Schnebel, geboren 1930,
ist einer der maßgeblichen deutschen zeitgenössischen Intermedia-Komponisten.
Anregende Einflüsse durch die Musik der Wiener Schule, die Schriften
Adornos, durch die frühen Kompositionen Nonos und Stockhausens, später
durch John Cage. Schwerpunkte seines musikalischen und didaktischen Schaffens:
Kompositionen einer Musik aus optischen Elementen (sichtbare Musik): ki-no
(als musikalische Schriftbilder dokumentiert in seinem Buch Mo-No);
Musik aus Bewegungen der Artikulationsorgane, wie die Maulwerke; Konzeption
einer psycho-analytischen Musik. Die Titel seiner umfangreichen musikalischen
Zyklen seit 1973: Schulmusik, Re-Visionen (I-II), Tradition,
Psychio-Logia, Laut-Gesten-Laute, Zeichen-Sprache, Speromenti.
Zahlreiche theoretische Schriften (Denkbare Musik), und Biografien
u.a. über Mauricio Kagel. Seit 1972 regelmäßige multimediale
Performances und Konzerte mit jungen Musikern und Studenten. Von 1976 bis
1996 Professor an der Hochschule der Künste Berlin.
Dieter Schnebel: Maulwerke – für Artikulationsorgane und Reproduktionsgeräte
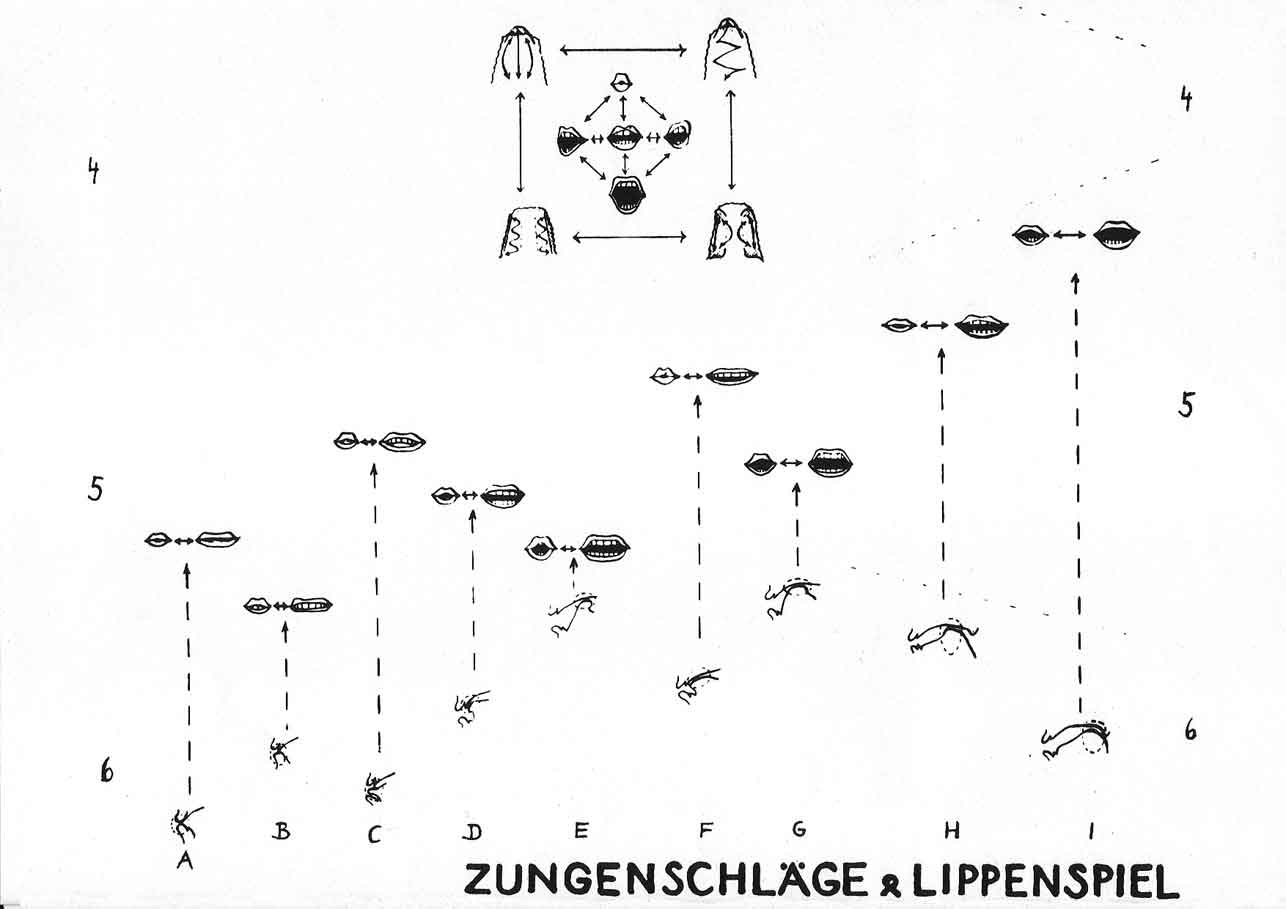
Dieter Schnebel: Maulwerke (Ausschnitt), © B. Schott's Söhne
Wolfgang von Schweinitz: Naturgesang mit Fröschen und Rotbauchunken
Unmittelbar nach dem Tod meiner
Mutter und meines Vaters war ich Anfang 2000 zur Erholung vier Monate lang
im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Dort habe ich meinen ersten, mit/dank
der posthumen finanziellen Unterstützung der Eltern erworbenen Computer
ausprobiert und die 1997 herausgekommene Musiksoftware Max/MSP studiert.
Nach der groben Zäsur hat es mir sehr geholfen, etwas für mich radikal
Neues anzufangen. Und es waren die Frösche da mit all ihren Frühlingshormonen
– dazu noch sogar die hier bei uns fast schon ausgerotteten Rotbauchunken.
Also lag es nahe, am ersten Abend im Mai mit zwei guten Mikrophonen einmal
ins Moor zu gehen, um die 74 Minuten komplexminimaler Musik für die CD
so stereophonisch wie möglich einzufangen.
Die nicht edierte Originalaufnahme aus der Wiepersdorfer Wasserheide wird
im Café des Hamburger Bahnhofs zu hören sein, während ich
sie zugleich im überakustischen Nebenraum mit meinem ersten eigenen MSP-Konzertprogramm
im Spontanvollzug der livedigitalen Klangeinspielung quadrophonisch moduliere.
Hoffentlich gelingt es dabei, etwas zumindest von der Frische & Freude
des allerersten Computerspiels noch einmal wieder entstehen zu lassen.
Wolfgang von Schweinitz, in: Physiognomien des Lautens, Programmheft, Juni 2002
Wolfgang von Schweinitz
Nach ersten Kompositionsversuchen
seit 1960 studierte er 1968-75 bei Esther Ballou an der American University
in Washington, D. C., sowie bei Ernst Gernot Klussmann und György Ligeti
an der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg und danach ein Jahr
im Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) am Stanford
Artificial Intelligence Laboratory in Kalifornien.
Es folgten einige ausführliche Reisen. 1977-78 lebte er in München
und 1978-79 als Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Im Sommer 1980 war er
Dozent bei den Internationalen Ferienkursen in Darmstadt. Nach zwei Jahren
in Berlin zog er 1981 aufs Land, erst in die Lüneburger Heide und dann
nach Schleswig-Holstein, wo er zehn Jahre zurückgezogen am Deich der
Eider verbrachte. 1993 ging er zurück nach Berlin. Im April und Mai 1994
war er an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar
als Mitarbeiter an der Studienreform engagiert, und im Oktober 1994 übernahm
er dort bis März 1996 eine Gastprofessur für Komposition.
1986-89 arbeitete er an einem abendfüllenden Stück Musiktheater
(PATMOS, nach der Apokalypse des Johannes), 1991-96 an einem symphonischen
Zyklus für Violoncello und Orchester (wir aber singen) und seit 1997
mit digitaler Live-Elektronik an der Neu-Intonation einer erweitert natürlichen
Stimmung (Helmholtz-Funk; JUZ, ein Jodelschrei; KLANG auf Schön Berg
La Monte Young; Tristan-Intonation; KOAN James Tenney PLAINSOUND MUSIC Harry
Partch).
Wolfgang von Schweinitz lebt freischaffend in Berlin.
Akio Suzuki: Ta Yu Ta 1
Ensemble Zwischentöne:
Musik für den Blick nach draußen
von Volker Straebel
Im letzten Konzert gab es Uraufführungen aus Bambusklängen von Akio Suzuki. Im Aktionsraum des Hamburger Bahnhofs interpretierte Peter Ablingers Ensemble in ruhiger Konzentration die teils grafisch, teils verbal notierten Partituren Suzukis. Der Klang- und Performance-Künstler hatte das Glück, auf für seine Klangexperimente offene und rnit den ihnen eingeräumten Freiheiten respektvoll umgehende Musiker zu treffen. In „bambrock“ zupften und rieben sie an zwei im vergangenen Jahr für die Galerie gelbe musik entstandenen Klangskulpturen – je neun in einen Betonsockel eingelassenen Bambus-Spalten. Die bogenförmige Verdichtung und Ausdünnung mit ein bis sechs und zurück zu zwei Spielern führte zur irrationalen Überlagerungen dunkel perkussiver Klänge, die die Ruhe von Absichtslosigkeit und Zufall atmen.
Ähnlicher Intention, wenn auch präziser in der kompositorischen Vorlage, folgt „kyurukyuttsu“, in dem drei Spieler rnit feuchten Fingern auf 60x60 Zentimeter großen Glastischen reiben. Das polyphone Quietschen und Sirren orientiert sich an unter den Tischen plazierten, grafischen Vorlagen, die der Dirigent nach und nach auswechselt und dabei dem Publikum zeigt, was es zuvor hören konnte. Eröffnet und beschlossen wurde dieser Zyklus „Ta Yu Ta I“ schließlich von zwei Soli Suzukis, dem rituell eröffnenden Umrunden des Publikums mit einem ins Rauschen changierenden, immer wieder von einer kurzen Wechselnote unterbrochenen Liegeton einer Steinflöte und dem wiederum in irrationalen Rhythmen trillemden, feinen Klingen einer perkussiv gespielten Glasharmonika. Auch diese Konzertstücke lassen die großen Meditations-Performances Suzukis ahnen, obwohl sie an die Situation ihrer Aufführung die Konzession der Kürze machen.
Volker Straebel, veröffentlicht in: Positionen – Beiträge zur Neuen Musik, August 2001
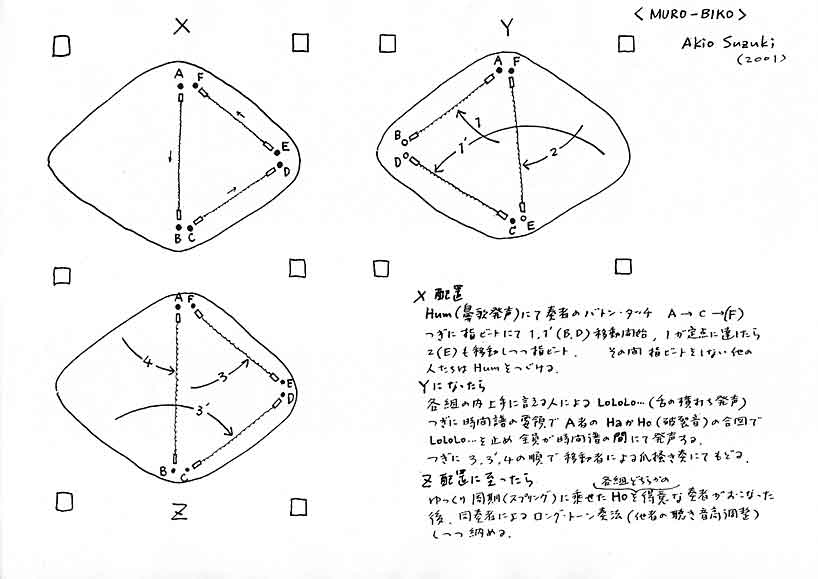
Akio Suzuki: Muro-Biko (Ausschnitt)
Akio Suzuki: tayutai (Probenphoto) Zum Klangkonzept
von Akio Suzuki [...] Man weiß,
daß John Cage wesentliche Anregungen dem Zen-Buddhismus und der Klangauffassung
japanischer Musik verdankt. Für den mit westlicher Tradition verbundenen
Betrachter oder Hörer bleibt dieser Hintergrund jedoch weitgehend abstrakt.
Aus westlicher Sicht, die immer noch durch lineares Denken und durch Betonung
des subjektbezogenen Standpunktes geprägt ist, ist es schwer vorstellbar,
daß bestimmte Wahrnehmungsformen, die im Westen als Innovationen gelten,
anderenorts integraler Bestandteil einer langen Tradition sind. Die japanische
Musiktradition und die dieser zugrundeliegende Klangauffassung machen z. B.
keinen Unterschied zwischen Klang und Geräusch (die westliche Musiktradition
mit der Dominanz bestimmter Klangfarben und ihrer Harmonieorientierung hat
die unorganisierten Klänge der Natur und des Alltags lange ausgeklammert).
Von Bedeutung für die Wahrnehmung in der Kulturtradition des fernen Ostens
ist auch die starke visuelle Orientierung durch die bildhafte Schrift. Schon
in der Sprache sind Klang und bedeutungstragendes Bild viel enger verbunden
als in unserer Sprache, in der die Schriftzeichen ohne eigentliche Bedeutung
sind. Während in der westlichen Musik die Klangfarben der Instrumente
der linearen Entwicklung des musikalischen Geschehens untergeordnet sind,
unterstützen sie in der japanischen Musik die räumliche Wahrnehmung
der Klänge. Aus:
Bernd Schulz, Werfen und Folgen – Zum Klangkonzept von Akio Suzuki. In:
Akio Suzuki, "A" – Sound Works, Saarbrücken 1998 Akio Suzuki:
Muro-Biko (Ausschnitt) Akio Suzuki Geboren 1941 in Pjöngjang
als Sohn japanischer Eltern. In den sechzigerer Jahren Beginn der Self-Study
Events. Siebziger Jahre: Bau einer Anzahl von Klangobjekten wie z. B.
das Echoinstrument Analapos; Klangausstellung in der Minami Gallerie,
Tokyo 76; Festival d'Automne à Paris 78. Achtziger Jahre: Stipendium
der Rockefeller Foundation (A.C.C.), New York 81; Entwicklung der konzeptuellen
Klanginstallationsreihe Throwing and Following; Performing Original
Music, Japan House, New York 83; Pro Musica Nova, Bremen 84; documenta
8, Kassel 87; Space in the Sun, Bau eines Raumes auf dem japanischen
Normalmeridian, um zur Herbsttagundnachtgleiche der Natur zu lauschen, Amino,
Kyoto 88. Neunziger Jahre: Einzelklangausstellung und -performance + -
0, Xebec, Kobe 93; Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD 94;
Inventionen, Berlin 94; Contemporary Music Forum of Kyoto 95; sonambiente
festival, Berlin 96; Stadtgalerie Saarbrücken 97; Donaueschinger Musiktage
98; Soundculture, Auckland, Neuseeland 99; Klang Kunst Festival – und
II, Wiesbaden 99; gelbe Musik, Berlin 99; daadgalerie, Berlin 99-00. James
Tenney: Swell Piece No 2 Peter Ablinger,
in: Neue Musik in Kreuzberg, Programmheft Mai 1994 
von Bernd Schulz
Die Unterschiede im kulturellen Kontext müssen mitbedacht werden, wenn
man sich dem Werk von Akio Suzuki nähern will. Seine künstlerische
Arbeit steht zwar deutlich im Kontext zeitgenössischer Entwicklungen,
die für die Klangkunst von Bedeutung sind, z. B. Fluxus oder Konzeptkunst
und Minimalismus. Andererseits ist Suzukis Offenheit für die Klänge
der Natur mit einer meditativen Grundhaltung verbunden, die das Selbst nicht
so radikal ausschließt, wie dies bei Cage der Fall war. Für Suzuki
genügt es nicht, einfach die Ohren für das Unerwartete zu öffnen
(wie Cage bei seinen Klangspaziergängen), sondern die spezifischen Klangqualitäten
eines Ortes, d. h. die objektiv vorhandenen Qualitäten, müssen mitberücksichtigt
werden. Wie kaum ein anderer ist er Klangqualitäten auf der Spur, die
zum Atmosphärischen eines Ortes, eines Raumes oder bestimmter Materialien
gehören. Er kann sich dabei nicht nur auf sein eigenes langjähriges
Training verlassen, wenn er mit Klanghölzern oder der eigenen Stimme
einen Raum oder einen Ort auf die Struktur des Nachhalls hin untersucht. Er
tut dies gleichzeitig mit der Sicherheit eines Menschen, der sich im Einklang
weiß mit einer alten kollektiven Erfahrung, wie sie z. B. in der Tempelarchitektur
Japans konkret eingeschrieben ist. Die Echopunkte, die Suzuki bestimmt, sind
Orte besonderer Wahrnehmung, sozusagen Brennpunkte des Atmosphärischen,
in dem höchste Aufmerksamkeit und Ruhe für den Betrachter / Hörer
zusammenfallen können. (Interessanterweise gibt es auch negative Orte,
die eine meditative Ruhe nicht zulassen und die früher mit bösen
Geistern in Verbindung gebracht wurden.)
[...] Das Klangerlebnis, sagt Suzuki, ist immer eng verbunden mit der Hörerfahrung
des Individuums, aber auch mit der „Gestimmtheit“ des eigenen Selbst.
Klänge und Geräusche sind das Medium, über das sich die Prozeßhaftigkeit
der Natur erschließt, eine Prozeßhaftigkeit, in die alle Dinge,
auch das menschliche Leben, eingebettet sind. Die Auffassung vom Klang als
Ausdruck der Spiritualität der Natur hat ihre Wurzeln im Shintoismus,
der alten Naturreligion, die bis heute, neben dem Buddhismus, Leben und Denken
des Japaners bestimmt. (Man fühlt sich an ein Wort John Cages erinnert,
der Klang sei die Seele eines unbelebten Gegenstandes.) Das tägliche
Spiel auf der Steinflöte, das Suzuki, wann immer es ihm möglich
ist, wie ein Ritual vollzieht, hat für ihn nicht nur die Bedeutung einer
Einstimmung, das Spiel verbindet ihn auch mit einer uralten Tradition, die
bis in die vorchinesische Zeit (vor 1500 v. Chr.) zurückreicht, als die
schamanistischen Praktiken, durch Klänge die Stimmen der Götter
hörbar zu machen, noch nicht verboten waren. (Mit einer Mischung aus
Stolz und Ironie erzählt Suzuki gelegentlich, daß sein Name übersetzt
„Schellenbaum“ bedeutet und damit auf ein altes schamanistisches
Instrument verweist.) [...]
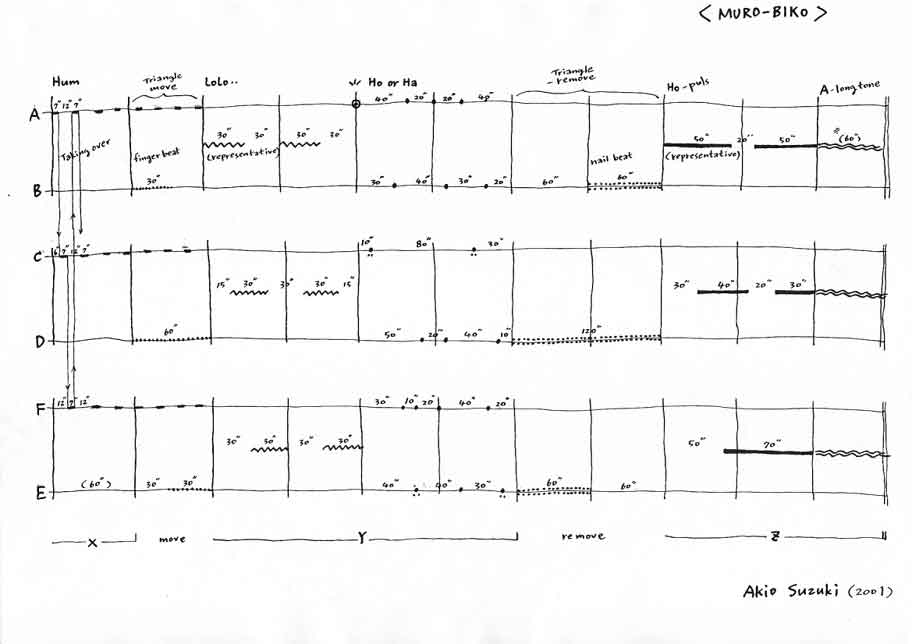
Das „Swellpiece No 2“ stammt aus der Reihe der „Postkartenstücke“,
die deswegen so heißen, weil die Anweisungen für ein Stück
nicht mehr Platz beanspruchen als den einer Postkarte.
Ein Kosmos klanglicher Möglichkeiten aus einem Kern einiger schlichter
Anweisungen. Alles aus Einem: Konzeptualität par excellence.
Es ist nicht das erste „Postcard Piece“, das wir im Programm führen.
Einige mögen sich noch an das großartige Tamtam-Stück erinnern:
Hat man je zuvor wirklich ein Tamtam gehört?
Und hier bei dem Swellpiece, glaube ich, kann man tatsächlich feststellen,
daß Klangfarbe eigentlich eine harmonische Kategorie ist. Bedingt durch
die einfache Konstellation des An- und Abschwellens der Klänge ensteht
so etwas wie eine ständige und sich ständig variierende Modulation
von Klangfarbe, die die Sogwirkung und sogar die Expression der harmonischen
Modulation als grobschlächtigen Vorfahren erscheinen läßt.
Bei den Proben zu diesem Stück habe ich eine überrraschende Beobachtung
gemacht: Wenn ich mich selbst langsam bewegte, oder auch nur den Kopf langsam
wendete, konnte ich ganz deutlich der Reihe nach die Obertöne des gespielten
Klanges hören. Sie liegen sozusagen an bestimmten Stellen im Raum verteilt;
fein säuberlich der Reihe nach aufgeschlichtet. Jeder kann sie auffinden
und seine eigene Melodie daraus machen.
Mark Trayle: this moment is empty
Digital trash from CPU hash and hard disk crash, laid out on a grid of 1000 0.125 second beeps at 1000hz like the signals broadcast by shortwave to synchronize our watches. Small errors magnify uncoordinated universal time. Small windows amplify an illuminated silence.
Mark Trayle
Mark Trayle works in a variety of media including live electronic music,
installations, improvisation, and compositions for wireless chamber ensembles.
He has performed and exhibited at experimental music and media venues in the
U.S., Canada, and Europe including Experimental Intermedia Foundation, The
Kitchen, Metrònom and MeX. He was a featured performer at Ars Electronica
'94, Sonambiente (Berlin, 1996), Le Festival de la Vallée des Terres
Blanches (Hérimoncourt, France, 1997), Resistance Fluctuations (Los
Angeles, 1998 and 2000), the net_condition festival at ZKM (Karlsruhe, 1999),
Pro Musica Nova (Bremen, 2000), and Format5 (Berlin 2001).
He has received grants from Arts International and the National Endowment
for the Arts, and commissions from Radio Bremen, the California Ear Unit and
Champ D’Action (Belgium). He has been an artist-in-residence at Mills
College, STEIM (Amsterdam), and The Lab (San Francisco). Trayle has collaborated
with Wadada Leo Smith, Vinny Golia, Nels Cline, Jeff Gauthier, KammerEnsemble
Neue Musik Berlin, David Behrman, and as a member of The Hub, with Alvin Curran
and the Rova Saxophone Quartet.
Trayle's music has been the subject of articles in Strumenti Musicali and
Virtual (Italy), Keyboard (USA), and "Escape Velocity: Cyberculture at
the End of the Century" (Grove/Atlantic). He has recorded for the Artifact,
Atavistic, CRI, Inial, Los Angeles River, Elektra/Nonesuch, and Tzadik labels.
Zur Site von Mark Trayle: http://music.calarts.edu/~met/
Christian Wolff: Berlin Exercises
Unverhoffte Glücksmomente musikalischer Inspiration –
Das Ensemble Zwischentöne porträtierte den amerikanischen Komponisten
Christian Wolff
von Matthias R. Entreß
Was für Chopin die Etüden
waren, sind für den amerikanischen Komponisten Christian Wolff die „Exercises“,
kleine Übungen experimentellen Komponierens, Spielens und Hörens.
Auch bei Wolff ist darin die Essenz seines ganzen Schaffens enthalten. Der
1934 in Nizza geborene Sohn des expressionistischen Verlegers Kurt Wolff und
jüngstes Mitglied der New York School um John Cage und Morton Feldman
war dieser Tage in Berlin, um mit dem Ensemble Zwischentöne unter anderem
seine neuen Berlin Exercises 1-4 aufzuführen.
Diese Stücke, wie alles von Wolff, verweigern dem Hörer den Dienst,
sofern dieser Musik als Seelenmassage oder ausdrucksvolle Unterhaltung versteht.
Sie sind mitunter von geradezu schockierender Sprödheit. Doch im Porträtkonzert
im ausverkauften Ballhaus Naunynstraße öffneten sich die Tore zu
Wolffs Ästhetik, die weniger den Klang als das zum Klingen gebrachte
musikalische Handeln zum Inhalt hat.
In den frühen Exercises wie Nr. 14 von 1974 haben alle Musiker dieselben
Noten vor sich. Es gibt weder Notenschlüssel noch Taktstriche. Indem
die Phrasen zeitlich frei voneinander versetzt werden, ergibt sich ein vielstimmiges
Gewebe von Imitationen in verschiedenen Tonarten gleichzeitig. Das ist nicht
etwa ein Durcheinander; die einzelnen Phrasen sind so gebaut, dass sie sich
in in fließender Natürlichkeit selbst antworten. Nur das Klavier,
von Wolff schwelgerisch gespielt, hat seine eigene Stimme. Als Ganzes haben
die Stücke eine immer neue Form, zum Beispiel eines lebendigen inneren
Monologs (Nr. 14) oder einer schillernden All-Over-Fantasie (Berlin Exercise
1). Mit zehn underschiedlichen Instrumenten von Vibraphon bis Tuba ist das
Höchstmaß an Farbigkeit erreicht.
Bei den hier uraufgeführten „Berlin Exercises“ müssen
die Musiker auch die Reihenfolge der Phrasen selber festlegen, eine Aufführungsstrategie
entwickeln. Wahrnehmung der anderen wird zur unabdingbaren Voraussetzung des
Musizierens, die Musik zum Modell eines selbstbestimmten Miteinanders. Ein
Lied auf Brechts „Vergnügungen“ lieferte das Motto des Konzerts.
Das Gedicht, das ausschließlich Begriffe aufzählt, rechnet neben
Schwimmen, Schreiben und Dialektik auch die Neue Musik zu den Vergnügungen.
Zurecht, wie der Abend bestätigte.
John Cage hatte Wolffs Exercises mit der klassischen Musik einer unbekannten
Zivilisation verglichen. Es gibt wohl kaum ein Ensemble, das besser als Zwischentöne
vorbereitet ist, mit dieser Fremdheit vertraut zu machen. 1988 als Folge eines
Kurses an der Kreuzberger Musikschule vom österreichischen Komponisten
Peter Ablinger gegründet, der das Ensemble auch heute noch leitet, hat
es lange im Ruch des Amateurhaften gestanden. Heute sind nur drei der Mitglieder
keine Berufsmusiker. Das Ensemble leistet sich aber nach wie vor den „unprofessionellen“
Luxus, die musikalischen Konzepte zwischen Komposition und Improvisation in
sehr langer Probenzeit zu erforschen. Es führt Musik auf, die im Rahmen
philharmonischer Geschäftigkeit gewöhnlich unter den Tisch fällt.
Zwei weitere ungewöhnliche Komponisten werden in den nächsten beiden
Konzerten porträtiert: Der aus dem Iran stammende Nader Mashayekhi (16.
6.) und die Texanerin Pauline Oliveros (27. 6.).
Mashayeckhi, der seit 1978 in Wien lebt, komponiert Musik, in der Entwicklung
nur als gewonnene Erfahrung, aber kaum direkt miterlebbar vorkommt. In den
großflächigen, und in sich durchaus lebhaften Stücken sammeln
sich -- ohne Übertreibung -- Hunderte von Anfängen. Für Pauline
Oliveros, die Komponistin und Akkordeonistin, ist das Ensemble Zwischentöne
das ideale Medium. Schon seit 30 Jahren komponiert sie nur noch mittels Beschreibungen,
was bei den Interpreten ein Höchstmaß an musikalischer Einfühlung
voraussetzt. Ihre Methode des „Tiefen Lauschens“ gestaltet Reaktionen
auf Umweltklänge. Oliveros: „Versuche nicht, den Klang zu ändern,
lass den Klang sich selber ändern.“
Matthias R. Entreß, unter dem Titel „Schockierend spröde und aufregend zugleich“ veröffentlicht in: Berliner Morgenpost, 13. Juni 2000
Exercises
There are three collections of
“Exercises”, 1–14 (1973–74), 15–18 (1975) and “Berlin
Exercises 1–4” (2000). (The title “Exercise” has also
been used for various other pieces, now at number 28.) “Exercise”
indicates relatively shorter pieces in which the process of work, of practising
and of trying things out within specified limits, in short a kind of discipline
in process, are being attempted. I regard them as both exercises in com-posing
and for performers, especially as the performers function as members of an
ensemble.
The set 1–14 leaves open the instrumentation and number of players. All
read from the same music, applying clefs variously, freely and to accomodate
an instrument’s range. Coordination is flexible, unison only a point
of reference. Various kinds of heterophony are worked out in the actual time
of performance, improvised.
The set 15–18 was first intended for four players including a pianist
(15) and a trom-bonist (17). Though hardly recognizable, some song material
is used (“Union Maid” – Woody Guthrie, and “Halleluja,
I’m a bum!” – a famous hobo song, and a song of my own, “Of
all things”).
The “Berlin Exercises” were written for the Ensemble Zwischentöne:
1, 2 and 4 for free instrumentation and three with a particular part for each
of eight of the ensemble’s players, including a vocal part which uses
the Brecht poem „Es war einmal ein Kind“. Heterophony is sometimes
posssible (especially in 1) but mostly each player has her own material, played
independently but with an ear – improvising with contingency – for
what is being played by the others.
Exercise X stands alone. Though having various possible realizations, it needs
to be organized before its performance in ways that produce more the effect
of a compo-sition completed before, rather than in the process of its performance.
With Exercises 1–14 unison songs on political texts were orginally written
to be sung by the players between the playing of groups of the exercises.
Now there is a song on Brecht’s poem „Vergnügungen“.
Christian Wolff, Juni 2000
Exercises
Es gibt drei Sammlungen von „Exercises“:
1–14 (1973–74), 15–18 (1975) und die „Berlin Exercises
1–4“ (2000). (Der Titel „Exercise“ wurde auch für
verschiedenen andere Stücke verwendet, die jetzt bis zur Nummer 28 reichen.)
Das Wort „Exercise“ (dt. „Übung, Aufgabe“) weist
auf verhältnismäßig kurze Stücke, in denen der Prozeß
des Arbeitens, des Übens und des Ausprobierens von Dingen innerhalb bestimmter
Rahmen, kurz eine Art von Disziplin im Verlauf, angestrebt wird. Ich betrachte
sie sowohl als Übungen im Komponieren als auch für die Interpreten,
besonders wenn die Interpreten ein Ensemble bilden.
Die Gruppe 1–14 läßt die Besetzung und die Anzahl der Spieler
offen. Alle beziehen sich auf dieselben Noten, wenden aber die Notenschlüssel
in verschiedener, freier und für den Tonumfang des Instruments passender
Weise an. Das Zusammenspiel ist flexibel, das Unisono nur ein Bezugspunkt.
Verschiedene Arten von Heterophonie werden während der Aufführung
improvisierend erarbeitet.
Die Gruppe 15–18 war anfangs für vier Spieler einschließlich
eines Pianisten (15) und eines Posaunisten (17) gedacht. Obwohl kaum erkennbar
ist das Material einiger Lieder verwendet („Union Maid“ von Woody
Guthrie, „Halleluja, I’m a bum!“ – ein berühmtes
Landstreicher-Lied und ein Lied von mir – „Of all things“).
Die „Berlin Exercises“ wurden für das Ensemble Zwischentöne
geschrieben: 1, 2 und 4 für eine freie Besetzung und 3 mit einem besonderen
Part für jeden der acht Spieler des Ensembles, darunter ein vokaler Part,
der das Brechtsche Gedicht „Es war einmal ein Kind“ verwendet. Gelegentlich,
insbesondere in 1 ist Heterophonie möglich, aber meistens hat jeder Spieler
ihr / sein eigenes Material, das unabhängig von den anderen, doch mit
einem Ohr bei ihrem Spiel – improvisierend mit dem Vorfindlichen –,
gespielt wird.
„Exercise X“ steht für sich allein. Obwohl es verschiedene
mögliche Realisierungen gibt, muß es vor der Aufführung derart
organisiert werden, daß eher der Eindruck einer zuvor fertiggestellten
als einer während des Aufführungsprozesses entstandenen Komposition
entsteht.
Mit den „Exercises 1-14“ wurden ursprünglich einstimmige Lieder
zu politischen Texten geschrieben, die die Spieler zwischen Abschnitten der
Exercises sangen. Diesmal ist es ein Lied auf Brechts Gedicht „Vergnügungen“.
Christian Wolff, Juni 2000
Die Algebra des
Alltagslebens
von Frederic Rzewski
Die erste Begegnung mit der Musik
von Christian Wolff hinterläßt den Eindruck, als ob man gerade
etwas von einem anderen Stern gehört hat, das anders ist als alles bisher
Vernommene. Und doch bemerkt man beim Nachdenken darüber, daß es
gleichzeitig etwas ganz Gewöhnliches und Normales ist, auf seine Weise
so vertraut, wie jede der ritualisierten Handlungen, die unser Alltagsleben
bestimmen: Morgens aufstehen, zur Schule gehen, Arbeit, Kirche, Geschirr abwaschen,
die täglichen Aufgaben im Haus und in der Familie erledigen.
Sonderbare kleine Melodien, die klingen, als ob sie zu einem entfernten Punkt
im Universum geschickt worden wären und dann als eine Art intergalaktisch
mutierte Musik zurückkommen; erkennbare rhythmische und melodische Muster,
die zu monströsen Paaren zusammengeflickt sind. Manche erinnern an die
Fabelwesen von Hieronymus Bosch, Gebilde aus Tieren, Fischen, Blumen und gebräuchlichen
Haushaltsgeräten: zwar gibt es Ordnung, aber auch ständige Unterbrechung,
das Aufdrücken untergeordneter Realität auf Regel- und Gesetzmäßigkeit,
vereint, um eine Wirkung sowohl von Vertrautheit als auch Fremdheit hervorzurufen:
Schklowskis „ostranenie“.
Man kann diese Musik für surrealistisch halten – ihre Formen sind
nicht vertraut, denn sie enthüllt hinter ihnen die Unberechenbarkeit
des Lebens. Man kann sie politisch nennen, improvisiert, mit kooperativen,
nichthierarchischen Formen sozialer Organisation befaßt – aber
man kann nicht sagen, wie sie wirklich ist (vielleicht traf John Cages Beschreibung
am ehesten zu, als er nach einer Aufführung der Exercises in New York
sagte, daß sie wie die klassische Musik einer unbekannten Zivilisation
wirke.
Sie läßt sich keiner Kategorie eindeutig zuordnen, sie gehört
zu keiner Schule, weder in New York noch in Kabul. Sie predigt keine Doktrin
und besetzt kein Territorium, obwohl sie in gewisser Weise die europäische
Notationstradition fortsetzt. Auch wenn der Komponist fast sein ganzes Leben
im universitären Bereich tätig war und zweifellos zur akademischen
Elite der Vereinigten Staaten gehört, kann seine Arbeit kaum akademisch
genannt werden. (Merkwürdigerweise hat diese Elite kaum jemals Interesse
für seine Arbeit als Komponist gezeigt.) Es ist eine schulschwänzende
Musik, eine Musik zwischen den Schulen. Ebenso weigert sie sich, als Abschreckung
für andere auf dem Arme-Sünder-Bänkchen zu sitzen.
[...] Es ist schwierig, Wolffs Verhältnis zur Politik genauer zu beschreiben,
obwohl politische Gedanken ohne Frage eine wichtige Rolle spielen. Ist er
wirklich ein feiger Liberaler? Ein Kommunist? Oder sogar etwas noch Schlimmeres?
Mir gefällt der Gedanke, daß er, sowohl traditionell als auch revolutionär,
eine Form von Wirklichkeitssinn ausdrückt – so wie der Kommunismus,
praktiziert in Familien und Dörfern der ganzen Welt, jahrhundertelang
existiert hat (siehe Kropotkin). Solcher „Wirklichkeitssinn“ könnte
eine Rolle in einer Massenkollektivbewegung des nächsten Jahrhunderts
spielen, und zwar in dreierlei Weise:
Erstens: Diese Musik ist anders als die meiste sogenannte „neue Musik“
nicht für den passiven Konsum gedacht, weder bei einer Konzertaufführung
noch als ein Stück Plastik, das man in einem Laden kauft. Sie ist vor
allem dazu gedacht, gespielt und nicht nur gehört zu werden (obwohl eine
gute Aufführung es natürlich wert ist, gehört zu werden.) Auch
wenn manches davon virtuos ist, kann ein guter Teil von Wolffs bemerkenswerter
Produktion von Amateuren aufgeführt werden. Jedermann mit gutem Willen
und etwas Verstand kann es tun. Diese Idee von Musik als etwas, das man tut
und nicht als etwas, das einem angetan wird, ist ebenso althergebracht wie
vorausschauend.
Zweitens: In Wolffs politischer Musik werden politische Ideen nicht nur durch
Texte vermittelt. Die Musik selbst beleuchtet diese Ideen. In „Wobbly
Music“ oder „Changing the System“ ist das Zusammenspiel der
Interpreten demokratisch, eine Tatsache, die eigentlich selbstverständlich
erscheint, in der notierten Musik jedoch selten vorkommt. Auf diese Weise
kann es nicht dazu kommen, daß die Ausführenden sich in revolutionärer
Rhetorik üben, während sie sich zur gleichen Zeit den unverändert
autoritären Formen unterwerfen.
Drittens: In der machistischen Welt der zeitgenössischen Musik liefert
Wolff das seltene Beispiel eines Komponisten, der in der Lage ist, sich in
einer Ästhetik auszudrücken, die zwar nicht explizit weiblich ist,
jedoch zumindest Sensibilität für die Erfahrungen von Frauen zeigt.
Diese politische Komponente ist natürlich auch an die Frage der Improvisation
geknüpft. Improvisation ist die Kunst des Möglichen, und als solche
kommt sie in allen Bevölkerungsschichten vor. Die Armen müssen improvisieren,
um zu überleben: aber schließlich auch der Kaufmann, der General,
der Seemann, der Dieb und der Zauberer. Insofern kann sie, zumindest theoretisch,
Teil eines Modells für eine postrevolutionäre Sprache darstellen,
die Ausgleich und Solidarität unter den verschiedenen Klassen von Menschen
fördert. In den sechziger Jahren waren solche Ideen eine Zeitlang weitverbreitet
und übten erheblichen Einfluß auf viele Künstler aus (auch
auf mich). Wolffs „Spiel-Strategie“-Stücke der späten
fünfziger und frühen sechziger Jahre haben ihn für eine jüngere
Generation improvisierender Musiker wie John Zorn und seine Kollegen fast
zu einem Helden stilisiert. Dennoch spielt Improvisation eigentlich kaum eine
wesentliche Rolle in Wolffs Musik, zumindest nicht aus meiner Sicht, außer
in einer umfassenderen Bedeutung, so wie man von einem Basketballspieler sagen
kann, daß er improvisiert, während er gleichzeitig die strengen
Regeln, die das Spiel bestimmen, einhält. Wolffs Improvisationsabläufe
beziehen fast immer eine begrenzte (normalerweise kleine) Anzahl von Entscheidungen
innerhalb eines genau abgesteckten Spielfelds ein – weit von der Improvisation
der sechziger Jahre entfernt.
Er ist immer noch einer der wenigen Komponisten, die gerade in den turbulenten
sechziger Jahren Improvisation überhaupt ernst genommen und sogar begriffen
haben, worum es dabei eigentlich geht. Wolff war niemals ein Hippie, nichts
läge ihm ferner, aber im Vergleich zu jener repressiven Schriftgelehrtheit,
die schon immer der Fluch der neuen Musik gewesen ist, wurde er bei mehreren
Gelegenheiten für schuldig befunden, sich mit einem regellosen Jazz zu
weit vorgewagt zu haben.
Für seine „Spiel-Strategie“-Arbeiten hat Wolff so etwas wie
eine algebraische Notation erfunden, die nicht nur für Tonhöhe,
Zeit und andere „Parameter“ gilt, sondern auch für die im Grunde
wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Spielern: kurz nach dem Klang
eines anderen Spielers beginnen, etwas tiefer oder höher ansetzen und
so weiter. Diese Partituren wollen die sich letztlich ergebende Klangstruktur
we-der be- noch vorschreiben, sondern stellen eine Landkarte dar, auf der
die Spieler herumreisen und mit jeder neuen Wendung unterschiedliche Ergebnisse
hervorbringen können.
Viele haben damals mit ähnlichen Ideen experimentiert, aber ich glaube,
daß Wolff immer besonders elegante Lösungen gefunden hat –
eben weil er sich nicht in dem Maß für das Endergebnis, sondern
für den Spielvorgang an sich – als Kunstwerk – interessiert
hat. Die symbolische Sprache dieser Stücke, anders als die der Mathematik,
bezieht sich nicht auf abstrakte Werte oder Quantitäten, sondern auf
Situationen aus dem wirklichen Leben (manchmal ziemlich wirre), deren Interpretation
einige Erfindungsgabe (einige würden Spitzfindigkeit sagen) erfordert.
Das Lesen dieser Partituren entspricht eher einem Waten (weder Schwimmen noch
einfachem Gehen) durch die schlammige Alltäglichkeit einer offensichtlich
gewöhnlichen, scheinbaren Klangwelt – eine Welt, über die wir
nicht nachdenken, sondern die wir schlicht als gegeben hinnehmen.
In der Aufführung durchforstet man diesen Sumpf, um Regelmäßigkeiten
und platonische Wesenheiten herauszufinden – nicht durch systematische
Abstraktion, sondern durch einmalige heuristische Begegnungen mit dem Unerwarteten
aufgrund der Wechselwirkung in einem System, das die Wahrscheinlichkeit von
Überraschungen erhöht, ohne ihre Gewißheit zu garantieren.
[...] Die tastenden, täppischen Rhythmen dieser Musik, ihre Eignung für
die Aufführung durch Amateure und Anfänger, die Kombination von
„richtigen“ Instrumenten mit Spielzeugen oder Krimskrams, ihre freiwillige
Öffnung gegenüber den Geräuschen der Außenwelt –
alle diese Dinge zeigen eine Ambivalenz, die sich weder bei der Tragödie
noch bei der Komödie, sondern irgendwo dazwischen befindet. Wie die lächelnde
Maske der „Bakchen“ des Euripides (ein Schauspiel, das genau zwischen
den Genres steht), entpuppt sich diese Musik sowohl als Einladung als auch
als Warnung, weil sie die Möglichkeit eines geistigen (und sinnlichen)
Erlebnisses in sich birgt, wenn wir offen dafür sind, ebenso aber auch
alles zerstören kann, wenn wir es nicht sind.
Erstveröffentlichung in: Christian Wolff: Cues. Writings & Conversations / Hinweise. Schriften und Gespräche. Herausgegeben von Gisela Gronemeyer und Reinhard Oehlschlägel. Edition MusikTexte 1998.
The Algebra of Everyday Life
by Frederic Rzewski
Your first encounter with the music of Christian Wolff leaves
you with the impression you’ve just heard (or played, or read) something
totally strange, unlike anything else you know. And yet, upon reflection,
you realize it is at the sarne time something completely ordinary and normal,
as familiar in its way as any number of repetitive actions characteristic
of everyday life, getting up in the morning, going to school, work, church,
washing the dishes, performing the daily tasks of home and family.
Weird little tunes, sounding as if they had been beamed at some remote point
in the universe and then bounced back again as a kind of intergalactic mutant
music; recognizable melodic and rhythmic patterns, somehow sewn together in
monstrous pairings, sometimes reminiscent of the demons of Hieronymus Bosch,
composites of animals, fish, flowers, and common household objects: there
is order, but also constant interruption, intrusions of disorderly reality
upon regularity and lawfulness, combining to create an effect of both familiarity
and strangeness: Shklovsky’s ostranenie.
You could say this music is surrealist—not reproducing familiar forms,
but revealing, behind these, life’s unpredictability. You could say it
is political; improvisatory; concerned with collaborative, non-hierarchical
forms of social organization; but you can’t really say what it is like
(although John Cage came close when he said, after a performance of the Exercises
in New York, that it was like the classical music of an unknown civillzation).
It does not fit neatly into any categories; it does not belong to any school,
neither of New York nor of Kabul. It preaches no doctrine and occupies no
territory, although it does continue in some way the European written tradition.
Although the composer has spent most of his life in school, and is unquestionably
a member of the American academic elite, his work can hardly be called academic.
(Curiously, this elite has paid almost no attention to his work as a composer.)
It is hookey-playing music, between schools. It even refuses to sit on the
maverick's stool in the corner, as a warning to others.
[...] It is difficult to define Wolff’s politics exactly, although clearly
political ideas play an important role in his work. Is he merely a lily-livered
liberal? a communist? or something even worse? I like to think he expresses
a form of common sense, both traditional and revolutionary at the same time—just
as communism, as practiced in families and villages all over the world, has
existed for centuries (compare Kropotkin). Such “commonsense” music
might play a part in some mass collective movement in the next century, in
three ways:
1. This music, unlike most so-called “new music”, is not designed
for passive consumption, whether in concert performance, or as a piece of
plastic that you buy in a store. It is primarily meant to be played, rather
than merely heard (although, of course, a good performance is worth hearing).
Although some of it is virtuoso stuff, an important part of Wolff’s considerable
output can be performed by amateurs. Anybody with will and a certain understanding
can do it. This idea of music as something you do, rather than something that
is done to you, is both ancient and forward-looking.
2. Wolff’s political music does not merely use texts, for example, to
convey political ideas. The music is itself an illustration of these ideas.
In Wobbly Music or Changing the System the co-ordination of
the players is democratic, something that might seem obvious, but in fact
rarely happens in written music. So we do not have people on stage talking
revolutionary rhetoric while submitting to the same old authoritarian forms.
3. In the macho world of contemporary music, Wolff is a rare example of a
male composer who has been able to express, if not exactly a feminine aesthetic,
at least one which shows sensitivity to women’s experlence.
This political component is of course also related to the question of improvisation.
Improvisation is the art of the possible, and as such affects vastly differing
strata of the population: The pauper must improvise in order to survive; but
then so must the merchant, the general, sailor, thief, and magician. It could
therefore, theoretically at least, provide a partial model for some kind of
post-revolutionary language that would promote reconciliation and unity among
different classes of people; and for a while, during the sixties, such ideas
were widespread and exerted considerable influence on large numbers of artists
(myself included).
Wolff's “game-strategy” pieces of the late fifties and early sixties
have made him something of a hero for a younger generation of improvising
musicians, like John Zorn and his colleagues. Actually, though, improvisation
does not play an important part in Wolff’s music at all, at least not
in my view—except in a broader sense, as with a basketball player, who
may be said to improvise, while at the same time adhering to the strict rules
governing the game. Wolff’s improvisational schemes almost always involve
a finite (usually small) number of choices within a strictly defined playing
field—a far cry from the “free” improvisation of the sixties.
Still, he is one of the few cornposers who, even in the heady sixties, took
improvisation at all serlously—or indeed, even understood what it was
about. Wolff was never a hippie, far from it: but, compared with the repressive
orthodoxy which has been the curse of new music ever since its origins, he
has been found guilty, on a number of occasions, of some farout antinomian
jazz.
For his “game-strategy” works, Wolff devised a kind of algebraic
notation which accounted not only for pitch, time, and other “parameters”,
but also for certain basic contingency-relations between players: Begin slightly
after the sound of another player, slightly higher or lower, et cetera. These
scores do not de/prescribe the final resulting sound-structure, but provide
a map along which the players may travel, with each new move producing different
results.
Many composers at the time were expertmenting with similar ideas; but I believe
that Wolff was able to come up with particularly elegant solutions-precisely
because he was not so concerned with the final result, but with the game-process
itself as a work of art. The symbolic language of these pieces, unlike that
of mathematics, does not refer to abstract values or quantities, but to real-life
situations (and sometimes quite messy ones) whose interpretation may require
considerable ingenuity (sophistry, some might say). Reading through these
scores is rather like wading (neither swimming nor simply walking) through
the muddy everydayness of the apparently ordinary, self-understood sound world—a
world we don’t think about, but merely take for granted.
In the performance of these works, one sifts through the muck to extract regularities
and Platonic onenesses—not by systematic abstraction, but by one-at-a-time
heuristic encounters with the unexpected, through an interaction with a system
which maximizes the probability of surprise without guaranteeing its certainty.
[...]
The fumbling, groping rhythms of the music, its amateur—or beginner-quality,
the combination of “legitimate” instruments with toys or junk, its
voluntary opening to the noise of the exterrial world—all of these things
express an ambivalence that belongs neither to tragedy nor comedy, but something
between. Like the smiling mask of Dionysos in Euripides’ Bacchae
(a play which is likewise between genres) this music is both an invitation
and a warning, suggesting the possibility of a sensible (and sensitive) outcome,
if we are open to it, but also the possibility of everything caving in , if
we’re not.
In: Christian Wolff: Cues. Writings & Conversations / Hinweise. Schriften und Gespräche. Gisela Gronemeyer and Reinhard Oehlschlägel, eds. Edition MusikTexte 1998.
Sergei Zagni: Symphonie Nr. 2
Sowohl vom Klangbild als auch von
der Struktur her stelle ich mir bei diesem Stück etwas ganz im Geiste
Sofia Gubaidulinas vor. Doch während die Komponisten dieser Generation
alles genauestens in Noten setzten (gelegentlich in sehr komplizierter Weise),
wodurch der ausgedrückte Hauptgedanke (im russischen, literaturzentrierten
Geist) nur unterschwellig zu verstehen war, so ist es hier genau umgekehrt.
Mehr noch: Dieser Text ist eine Partitur, doch zugleich könnte dieser
Text auch ein Kommentar oder ein Essay sein – ein schriftstellerischer
oder musikwissenschaftlicher – zu einer Musik, die in der üblichen
Weise geschrieben und interpretiert wird (vor allem zur Musik Gubaidulinas).
Partitur und Kommentar sind zu einem Leib verschmolzen. Plötzlich wurde
mir klar: Wozu Noten schreiben, wozu eine solch beschwerliche und mühsame
Arbeit auf sich nehmen, wenn man es, mit einem gleichen oder sogar besseren
Ergebnis, auch bleiben lassen kann.
Ein Vergleich: Ein klassisches Werk ist ein Weg, der nur in eine Richtung
weist, und den man langsamer oder schneller gehen kann, während eine
offene, „variable“ Komposition einem Park oder Wald gleicht. Wer
in ihm spazieren geht, kann nicht nur den Charakter der Bewegung verändern,
Tempo und Dynamik variieren, sondern auch jedes Mal andere Pfade wählen,
von einem zum anderen übergehen, gelegentlich an einen Ort zurückkehren
usw. Im Park kann man länger spazieren gehen. In ihn möchte man
öfter zurückkehren, er vermag sich in größerem Maße
jedes Mal neu darzustellen.
Ein anderer Vergleich: Die variable Komposition ist ein vierdimensionaler
Körper, ihre einzelne Interpretation seine dreidimensionale Projektion.
Ein möglicher Gesichtspunkt: Schaffen heißt Grenzen erfahren. Nicht
immer ist alles augenfällig. Ein Werk begreifen, bedeutet unsere eigenen
Vorstellungen über unsere eigenen Grenzen und über die Grenzen des
Alls erfahren. Ein anderer möglicher Gesichtspunkt: An die Zahl glauben
heißt an Gott glauben.
Sergei Zagni, in: Klangwerkstatt 2000 – Neue Musik in Kreuzberg, Programmheft, November 2000
Sergei Zagni
Geboren 1960 in Moskau, ist ein
radikaler Experimentator und Konzeptkünstler. Seine Arbeit erstreckt
sich in fast alle kompositorischen Bereiche: Minimalismus, elektronische Musik,
Musiktheater, Happening, graphisch notierte Musik und auch in den Strukturalismus.
Seine Kompositionen sind häufig von der Mathematik beeinflußt und
selbst in den freien Genres immer strikt logisch aufgebaut. Viele der Stücke
sind als variable Strukturen angelegt, die den Spielern die Freiheit der Wahl
ermöglichen. Der Komponist versucht in ihnen den Kosmos im Ganzen zu
begreifen. Zagni tritt auch als Improvisationsmusiker am Klavier und mit nichttraditionellen
Instrumenten auf. Seine Musik wurde, außer in Rußland, in Italien,
Deutschland, den USA, England, Frankreich und der Schweiz aufgeführt,
u. a. auf den Festivals Alternativa (Moskau), Unbemerkte Bewegung (Volgograd),
Bang on a Can (New York), European Media Art Festival (Osnabrück), The
Third Mikhail Chekhov's Festival (Forrest Row, England), OPERATIVes Künstlehrfest
(Berlin), Kykart (Carskoe Selo), Edingburgh International Festival, Seminar
with Tom Johnson (Saint Germain les Angles), Moskauer Herbst und Mental Landscapes
(Frauenfeld, Neuchâtel, Zürich).
Werkauswahl: Four Canons, für Violine und Cello, 1981; Claviermusik aus
dem 17. und 18. Jahrhundert, für Orgel und/oder Klavier, 1978–82;
Sonate, für Klavier, 1990 (Zagni Edition: CD; Long Arms Records: CD);
Stück Nr. 4, für Klavier, 1991; Voces Organales, für Orgel,
1984 bis heute; Electronic Music No. 3 (Korg Music), 26.09.1993–28.04.1994;
Electronic Music No. 5 (Piano Concerto), 1995–06.10.1997 (Zagni Edition:
CD; Long Arms Records: CD); Symphonie Nr. 2, Kammerensemble oder Lesung, 22.09.–14.10.1995;
Sonata Reconstructed from Fragments the Order of which is Lost, elektronische
Musik, 1998 (Zagni Edition: CD; Long Arms Records: CD); Anthems, Requiem,
elektronische Musik, 1998 (Long Arm Records: CD); Stück Nr. 5, für
Klavier, 11.04.1999, Neujahrsmusik, CD, 02.2000 (Zagni Edition: CD); Magic
Stars, Tafeln für Piano oder ein anderes passendes Instrument (in Arbeit).
zeitblom: source music part II
Bei „source music part II“
wird akustisches Material, wie hier die Klänge des Ensemble Zwischentöne,
in überlagerten Bearbeitungen durch Setzung von Parametern eines Computerprogrammes
grob in Richtungen gelenkt. Ergebnisse werden vom Operateur verworfen oder
setzen sich in ästhetischen Entscheidungen evolutionär durch Aufnahme
für die weitere Bearbeitung durch. Schicht für Schicht entwickelt
sich ein akustischer Phänotyp, schält sich heraus als eine Möglichkeit
von vielen.
Im Substrat des Codes im Computer formen sich klangliche Ereignisse, im Detail
unbestimmt, von außen mäßig durch Erforschung und Erfahrung
vorhersehbar, nicht zu planen und darum in ihrem Werden um so interessanter
zu beobachten. Die komplexesten Muster werden geboren, nicht gemacht.
Der vorgelegte musikalische Versuch bemüht sich um den von dem amerikansichen
Schriftsteller Kevin Kelly geäußerten Optimismus: „Die Welt
des Gemachten wird bald wie die Welt des Geborenen sein: autonom, anpassungsfähig
und kreativ, aber konsequenterweise auch außerhalb unserer Kontrolle.
Ich denke das ist ein großartiges Geschäft.“
Die Musik der Do-CD Trilogie „Bioplex-biomorph-bioscope“ ist gemacht
für Kunsträume wie Installationen und Environments. Der als Titel
gewählte Neologismus „Bioplex“, eine Zusammenziehung des der
Sphäre der Natur zugeordneten „Bio“ mit „plex“, assoziativ
abgeleitet von einem technischen Instrument, dem künstlich akustisch
Räume simulierenden Gerät „Echoplex“ unter Anerkennung
der Mitschwingung von Konnotationen wie „(K)komplex“ als Adjektiv
wie Substantiv und den kulturellen Raum großer verbundener Gebäude
genauso meinend wie die wesentlichste Eigenschaft von aus zunächst einfachen
Regeln hervorgehenden natürlichen Systemen. „source music part II“
ist Teil der geplanten Do-CD Trilogie „Bioplex-Biomorph-Bioscope Environments“.
Erschienen ist bis jetzt „Bioplex in Delay – Environments # 1“
bei Tourette, Bayreuth, Juni 2001.
zeitblom, in: Musik für den Blick nach draußen, Programmheft, Juni 2001
zeitblom
lebt in Berlin und arbeitet in
diversen Metiers: Elektronik; Bass, Komposition, Klanginstallation, Neues
Hörspiel/Akustische Kunst, Sound-Environments.
Er gründete die Avant Rock Band Sovetskoe Foto (1984 – 93). Zusammenarbeit
mit Fred Frith, John Zorn, Arto Lindsay; Zeena Parkins, Pyrolator. Mitglied
des Improvisationsensembles ThoThmann Anlagen (1994 – 96). Komposition
der Musik-Theater-Skulptur Les Sortileges von Christian Marclay am Münchner
Marstall Theater 1996. Buch-CD-Projekte mit verschiedenen Autoren, u.a. Ulrich
Schlotmann, Theater/Hörspiel/DJ-Projekte mit Kalle Laar, Elektronik Duo
Golden Tone mit Christian Fennesz, Konzept Gruppe fennesz/rantasa/ zeitblom
– Isolationstank Projekt Bioadapter (1999 – 2001) und a sophisticated
soirèe (2001). Kompositionen für die Maschinengruppe BBM, Mitarbeit
an der Kunstedition Black Box ( Sonic Youth/Jim O'Rourke u. a.) Kunstmuseum
Ystad/Schweden 2000. Musiken für Theater und Tanz, Elektronische Lese-Performances,
Radio-Hörstücke, zahlreiche Veröffentlichungen und vieles mehr.
Aktuelle Veröffentlichungen: zeitblom – bioplex in delay environments
#1, tourette 2001; format 5 sampler – beitrag von golden tone –
17:14, tourette 2001; audiolounge sampler – beitrag von zeitblom/laar
– hypersound concrète intermedium rec. 2001; BBM/zeitblom –
sophisticated tactic by blind technic, tourette 2001.
Zur Site von zeitblom: http://www.zeitblom.de
Walter Zimmermann: Shadows of Cold Mountain 2
Das Stück gehört zu dem Zyklus „Erased-Retraced“ (1994-2000), der den bildnerischen und poetischen Raum Brice Mardens und Robert Creeleys mit einer Musik umkreist, die zwischen konturauflösenden Stücken: „Erased“ und konturbildenden Stücken: Retraced“ hin- und herpendelt. Die vier Stücke des Pols Erased übersetzen die gestisch-kalligraphischen Liniengeflechte von Brice Mardens Bildzyklus „Cold Mountain“ in Klang. Was bei Marden freiheitlicher Ausdruck einer losen, weiten und schweifenden Bildfolge ist, wird hier zum Grenzgang. Instrumente sind nicht für Grenzenloses gebaut, jede Freiheit kommt in Konflikt mit der Mechanik. Die schweifende Linie, in Musik übersetzt, wird nur durch strengstes Abmühen erfahrbar. So weit können Malerei und Musik auseinander liegen. Jedoch trifft sich Farbwelt und Tonwelt jenseits dieser Anstrengung, in Mannigfaltigkeit der Verbindungen der sekundären Klangprozesse der Interferenztöne und Differenztöne. Die primäre Gestik des Malens wird hier erst in der sekundären Klangebene wahrnehmbar, hinter der Struktur. – „Shadows of Cold Mountain 2“ bezieht sich auch auf ein Gedicht von John Yau:
|
In the Shadows of Cold Mountain |
In den Schatten des Kalten Berges |
|
Dust settles in first layers
of air between |
Staub legt sich in ersten
Schichten aus Luft zwischen |
Dazu John Yau : „Das Gedicht wurde nach den Malereien von Brice Marden geschrieben, die er Han Shan, dem Dichter des Kalten Berges, gewidmet hat. In seinen Gemälden „Notes for Cold Mountain“ zeichnet Marden vier senkrechte Spalten mit Couplets, die jeweils aus kalligraphischen Notationen bestehen. Ich dachte an Mardens Linien, die Art, wie sie sich drehen und wenden, zusammenkommen und doch unterschieden bleiben. Ich entschloß mich, „In the Shadows of Cold Mountain“ als eine Gruppe achtzeiliger Gedichte zu schreiben, deren jedes aus einem ununterbrochenen Satz oder einer „Linie“ von Gedanken und Assoziationen bestehen sollte. Als ich mir das Gewebe von Mardens Linien vorstellte – die Dichte und Luftigkeit der Gemälde –, dachte ich, die geschriebene Linie dürfe nicht die Linearität nachahmen, dürfe nicht von hier nach dort gehen, sondern könne stattdessen erforschen, was zwischen hier (wo immer das ist) und dort (was immer das ist) liegt.
Shadows of Cold Mountain 2
The piece belongs to the cycle
Erased-Retraced (1994–2000) which encircles the pictorial and poetic
realm of Brice Marden and Robert Creeley with a music that sways back and
forth between the contour dissolving pieces: Erased and the contour creating
pieces: Retraced. The four pieces centered on Erased translate the gestural-calligraphic
mesh of lines from Brice Marden's picture cycle Cold Mountain into sound.
What is by Marden freely expressed in a loose, broad and roaming succession
of pictures, here becomes a walk on the borderline. Instruments are not build
for boundlessness, each freedom comes into conflict with the mechanics. The
roving line, translated into music, is only discovered after the strictest
of toils. So far apart can painting and music be from each other. But beyond
this effort, the worlds of colour and of sound meet through manifold connections
in secondary sound processes, in interference tones and difference tones.
The primary gesture of painting here is only perceivable in the secondary
sound level, behind the structure. Shadows of Cold Mountain 2 also refers
to a poem by John Yau:
In the Shadows of Cold Mountain
Dust settles in first layers of air between
steps and sky above and below windows
overlooking yards behind buildings
furnished rooms old men and women
empty bottles cans fished out of bags
one talking about friends who left in carts
for countries with no names gets confused
in hallways leading to sunlit street
John Yau writes: "The poem was written after Brice Marden’s paintings
to Han Shan, the Cold Mountain poet. In his paintings, Notes for Cold Mountain,
Marden draws four vertical columns of couplets, each of which consists of
calligraphic notations. I thought of Marden's lines, the way they turn and
veer, come together and yet remain distinct. For In the Shadows of Cold Mountain,
I decided to write a group of eight-line poems, each of which would be made
up of one unpunctuated sentence or "line" of thoughts and associations.
Thinking of the web of Marden's lines – the density and airiness of the
paintings – I thought the written line did not have to mimic linearity,
did not have to go from here to there but could instead investigate what was
between here (wherever that is) and there (whatever that is)."
Zur Site von Walter Zimmermann: http://home.snafu.de/nanne.walter/
Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt