Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt
Komponisten / Stücke O – R
Pauline Oliveros: Sound Piece
In diesem Stück kann ein Klang
von jeder beliebigen Klangquelle herrühren. Der Klang kann kürzer
oder länger, leiser oder lauter, einfach oder komplex sein, soll jedoch
nicht als Teil oder Abschnitt einer Musik (z. B. aus dem Radio oder von einer
Aufnahme) erkennbar sein. Jeder Klang sollte einen eigenen Charakter haben.
Klänge, die schwer erkennbar sind, dürften interessanter sein. Klänge,
die von ungewöhnlichen Klangquellen stammen, oder in ungewöhnlicher
Weise erzeugt oder positioniert werden, dürften ein größeres
Interesse hervorrufen. Die Klangquellen können optisch interesssant sein
– oder auch nicht – und können auf die Bühne gebracht
werden, um die Aufführung klanglich, visuell oder dramaturgisch zu beleben.
Die Klänge können nah oder fern, von ortsfesten oder beweglichen
Klangquellen erzeugt werden.
Jeder Spieler bereitet eine Anzahl von Klängen vor, um sie innerhalb
einer festgelegten Dauer, z. B. zehn Minuten oder auch viel länger, vorzustellen.
Jeder Spieler kann so viel oder so wenig Klangquellen benutzen, wie sie oder
er möchte. Jeder Spieler ersinnt ein eigenes Zeitschema und eine eigene
Dramaturgie für die Klänge innerhalb der gegebenen Dauer. Das Stück
beginnt mit dem ersten Klang und endet, wenn die Zeit um ist.
Variation: Die Klänge werden entweder vor, nach oder gleichzeitig mit
dem Klang eines anderen Spielers erzeugt. Die Dauer des Stückes kann
zuvor festgelegt werden oder, wenn die Zeit nicht begrenzt ist, kann das Stück
auch fortgesetzt werden bis die Energie verbraucht ist.
Pauline Oliveros, 13. Juli 1998, Kingston NY
Sound Piece
In this piece a sound could come
from any sort of sound source. The sound could be shorter or longer, softer
or louder, simple or complex but not identifiable as a fragment or phrase
of music (from a radio or recording for example). Each sound used should have
its own character. Sounds that are difficult to identify might be more interesting.
Sounds that come from unusual sources, methods of activation or locations
might have more interest. The sound sources might be visually interesting
(or not) and could be staged to enliven the performance space in an interesting
audio as well as visual and dramatic design. Sounds could be local or distant
with stationary or moving sound sources.
Each person prepares a number of sounds to present within a predetermined
duration i. e. 10 minutes or much longer. Each person may have as many or
few sound sources as they want. Each person devises their own time scheme
and staging for their sounds within the given duration. The piece begins with
the first sound and ends when the time is up.
Variation: Sounds are activated either before, after or exactly with another
performer’s sound. The duration of the piece may be predetermined or
if time is not limited the piece could go on until the energy is spent.
Pauline Oliveros, July 13 1998, Kingston NY
Holzkisten durch
die Gegend kicken – Pauline Oliveros und das Ensernble Zwischentöne
erzählten in der Parochialkirche von den Geräuschen des Alltags
von Björn Gottstein
Gäbe es das TV-Quiz „Familienduell“
in einer Ausgabe für musikalisch Halbgebildete und lautete der vorgegebene
Begriff „Pauline Oliveros“, dann wäre „Om“ eine viel
versprechende Antwort.
Die 1932 in Texas geborene Komponistin und Akkordeonistin gilt heute neben
Meredith Monk als Leitfigur einer musikalischen Ästhetik, die sich entlang
den Koordinaten Spiritualismus und Feminismus angesiedelt hat. „Sonic
Meditations“ oder „Deep Listening“ heißen die meditativ
und ganzheitlich konzipierten Werke, die Pauline Oliveros der männlich
dominierten europäischen Konzerttradition entgegenhält.
Seit den 60er-Jahren verwendet sie dazu ausschließlich Verbalpartituren,
die auf die traditionelle Notenschrift verzichten und den Ausführenden
stattdessen großzügig Freiheiten einräumen. Es konnte am Dienstagabend
in der Parochialkirche also kaum überraschen, dass man den gesamten Partiturtext
von „Sound Piece“ aus dem Jahr 1998 auf einer halben Seite des Programmheftes
abgedruckt fand. Und die tunichtgute Unbestimmtheit der Partitur, die von
den Klängen verlangte, dass sie „kürzer oder länger, leiser
oder lauter, einfach oder komplex“ sein mögen, konnte die Erwartungshaltung
nur betonieren.
Erst mit den ersten konzertanten Aktionen wurde deutlich, dass man in der
folgenden Stunde etwas anderes zu erwarten hatte als Klang gewordene Spiritualität.
Denn unter der unvermeidlichen Inkonsistenz neun autark agierender Musiker
entwickelte sich „Sound Piece“ zu einer heterogenen, gelegentlich
durchaus zähen Klangcollage.
Im Mittelpunkt standen dabei die small sounds, die kleinen Gerausche, die
der Alltag abstrahlt und die oft unbemerkt an uns vorüberschallen: das
Rascheln einer Plastikfolie, das Klicken einer Blechdose oder das verhaltene
Knacken eines gespaltenen Holzstücks. Nur selten entfalteten sich dabei
kommunikative Strukturen. Der einsilbige Dialog über Trauer und Wehmut
etwa, in den sich Posaune und Akkordeon zu verstricken versprachen, dauerte
am Ende nur wenige Sekunden. Meist zogen einzelne Klangquellen die Aufmerksamkeit
auf sich, indem sie sich dominant in den Vordergrund spielten.
Die teuer verkabelte Gitarre etwa verströmte wundervoll dubbige Effekte,
spielte die Wucht der elektrischen Verstärkung aber auch kaltblütig
aus. Im Gegensatz zu den langatmigen und spannungsreichen Bögen, die
frühere Werke von Oliveros auszeichneten, kamen hier Gesten zum Tragen,
die dem Klischee einer friedfertigen und sinnlichen weiblichen Musikkultur
zuwiderlaufen: Nervosität und Bedrohlichkeit gehören ebenso dazu
wie die latente Aggressivität, die das schnoddrige Herumtreten von Holzkisten
verbreitete.
Am schwersten auf dieser Aufführung aber lastete die vermeintliche Willkür,
die auf musikalische Argumente wie Zyklus oder Linearität verzichtete.
Dass der Applaus schließlich zu früh einsetzte, noch während
der Kontrabass einige verwischte Streichgeräusche von sich gab, zeugt
von der Irritation und der Unsicherheit, die Oliveros und das Ensemble Zwischentöne
an diesem Abend entfesselten.
Björn Gottstein, die taz, berlin-kultur, 29. Juni 2000
Was ihr hören
wollt – Pauline Oliveros’ „Sound Piece“ in der Berliner
Parochialkirche
von Stefan Melle
Manch einem mag das Gefühl
vertraut sein, wenn eine Massage die Beschaffenheit des eigenen Körpers
in unerwarteter Weise spürbar macht. Jäh sind alle Sinne auf dieses
vielschichtige Körperempfinden gerichtet, daraus erwächst auch jenes
gleichzeitig Beruhigende und Erfrischende, das den Erfolg der Behandlung anzeigt.
Eine ähnliche Wirkung rief zunächst das Konzert des Ensembles „Zwischentöne“
am Dienstag in der Parochialkirche hervor. Die erstmals in Europa aufgeführte
Komposition „Sound Piece“ der Amerikanerin Pauline Oliveros begann
mit langem, stillen Sitzen. Dadurch wirken im Kirchenraum die leisen Geräusche
prompt lauter – der Wind in der Kuppel, letzte Schritte eines verspäteten
Besuchers, ein Rücken, der an der Lehne entlangschleift.
Dann beginnen die Spieler kaum hörbar eine Musik, die das Versinken lehren
will. Einzeln sind die Musiker im Raum verteilt und haben um sich herum ein
farbiges Sammelsurium von Instrumenten und Geräuscherzeugern angehäuft.
Das reicht von der Geige und Posaune, die indes nur begrenzt ihre Möglichkeiten
ausspielen, über Porzellanteller, Blechbüchsen und Würfeln,
die auf dem nackten Steinfußboden scheppern, klirren, klickern, bis
zu Raschelfolie, Kinderspielzeug und allerlei Kuriositäten, die an die
variantenreichen Klänge der Welt erinnern. Der Laut einiger Wassertropfen
eröffnet das Werk, fast unhörbares Pendeln, Quietschen und Quellen,
Sichballen, Trennen und Zerrinnen von Klängen, später auch Stimmen,
entwickeln es fort. Fast immer bewegt sich das Geschehen im leisen oder nur
vorsichtig lauteren Bereich. Selten nimmt es energische, nie dramatische Züge
an.
Freie Improvisation. Nun ist das alles in der Komposition von Oliveros so
nicht vorgeschrieben. Schon seit langem gibt sie den Musikern nur noch ungefähre
Handlungsanleitungen mit, wodurch diese zu Interpreten im umfassenden Sinn
des Wortes aufgewertet werden. Die Anweisung für „Sound Piece“
fordert dabei, dass die Musiker nach individuellem Ermessen beliebige eigene
Klänge von beliebigen Klangquellen während einer zuvor vereinbarten
Dauer produzieren. Zugespitzt heißt das: „Legt eine Zeitspanne
fest, macht darin, was ihr wollt, aber zitiert nicht.“ Solch eine Rahmensetzung
verzichtet freilich sowohl weitestgehend auf die Definition dessen, was im
Konzert erklingen oder an Beziehung erlebbar werden soll, als auch dessen,
was nicht zu hören und zu sehen sein soll. Sie läuft damit auf freie
Improvisation hinaus. Die Anweisung stellt für die Musiker nur noch den
Anlass dar. Dergestalt macht die viel beschworene Konzeptkunst sich selbst
überflüssig. Vielleicht trägt auch deshalb Oliveros „Klangstück“
den wohl allgemeinsten Titel, den ein Musikwerk führen kann.
Außer durch die gemessene Ruhe des gesamten Verlaufs wird das Stück
von der Faszination der vielen verschiedenen Klangnuancen getragen und von
der instinkti ven Neugier des Hörers auf das nächste, nicht vorhersehbare
Musikereignis. Doch bereits nach gut der Hälfte der 70 Minuten, die die
Musiker sich auszufüllen vorge nommen haben, zerfasert die Kraft des
musikalischen Geschehens beträchtlich. Zwar gibt es da immer noch unablässig
neue Klangereig nisse. Doch sie stellen sich doch nur alsVariante des schon
Gehörten heraus und gewinnen auch keinen weiteren Sinn als den, mittels
Fortdauer tiefer in die Seelenbalance eingreifen zu wollen. Der Hörer
jedoch beginnt, die Ziegelwände, Gewölbe und Balkenkonstruktionen
der Parochialkirche zu betrachten. Etwas grundlegend Neues hat er an diesem
Abend nicht erlebt, im Gegenteil begegnete er lange Bekanntem, das man hin
und wieder zur Erfrischung der Ohren gern wiederhört. Freilich nur in
angemessener Dosis. Denn irgendwann bewirkt auch die angenehmste Massage statt
der ursprünglichen Belebung eher fühllose Erschöpfung.
Stefan Melle, Berliner Zeitung, 29. Juni 2000
Die Wurzeln des
Augenblicks – Über das Hören
von Pauline Oliveros
[...] Meine Kompositionsweise wird
meist entweder als gewichtiger Beitrag zur neuen Musik gesehen oder aber als
Nicht-Musik abgetan, da sie nicht konventionell notiert ist und somit nicht
auf konventionelle Weise beurteilt werden kann. Sie wird abgetan, weil sie
nicht unbedingt in Noten aufgeschrieben ist oder weil die Spieler aufgefordert
werden, Rhythmen und Tonhöhen nach Konzepten zu erfinden oder auf Metaphern
zu reagieren. Musiker, die gewohnt sind, Noten und Rhythmen zu lesen, erschrecken
oft über die karge Notation im Vergleich zu gewohnten Partituren, die
ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Tonhöhen und Rhythmen lenken, die ihnen
vorhersagbar und wiederholbar vorkommen. Ich lege mehr Wert auf die unvorhersagbaren
und ungewissen Möglichkeiten, die eben dadurch zum Tragen kommen, daß
ich keine bestimmten Tonhöhen und Rhythmen vorgebe. Ich ziehe organische
Rhythmen den ausschließlich metrischen Rhythmen vor. Das volle Klangspekrtrum
ist mir lieber als ein umgrenztes Tonsystem. Innerhalb dieses umfassenden
Kontexts klangorientierter Komposition setze ich manchmal Metren und Skalen
ein.
Meine Musik ist interaktive Musik. Sie ist interaktiv in dem Sinn, daß
die Teilnehmer an der Schöpfung des Werkes teilhaben, anstatt darauf
reduziert zu sein, Töne und Rhythmen ausdrucksvoll zu interpretieren.
Ich habe den äußeren Rahmen, die Anleitungen, auf welche Art zu
hören und zu reagieren ist, komponiert. Diese Rahmen und Anleitungen
geben den Interpreten bei richtigem Gebrauch die Möglichkeit, kreativ
zu werden, mit mir zusammen zu komponieren und aufzuführen und ihr musikalisches
Spektrum zu erweitern.
Die Bandbreite der Notationspraktiken, die ich einsetze, um meine kompositorische
Arbeit vorzustellen, umfaßt die Notation im konventionellen Liniensystem,
graphische Notation, Metaphern, Prosa, mündliche Anleitungen und Aufnahmegeräte.
Die Sonic Meditations sind als Anweisungen oder Rezepte notiert. Die
schriftlichen Fassungen der Sonic Meditations entstanden erst
nach vielen Versuchen mit mündlichen Anweisungen, die an viele verschiedene
Menschen weitergegeben wurden. Obwohl sie im Druck erschienen sind, verändere
oder überarbeite ich öfters den Wortlaut, um diese Anweisungen in
neue Situationen überführen zu können.
Meine Anweisungen sind dazu gedacht, bei den Ausführenden und innerhalb
einer Gruppe einen Prozeß der Aufmerksamkeit auszulösen, der sich
mit der Zeit durch wiederholte Erfahrung noch vertiefen kann. Hier als Beispiel
ein Stück für Stimmen oder Instrumente: „Three Strategic
Options – Gemeinsam horchen. Wer bereit ist anzufangen, wählt
eine der drei folgenden Möglichkeiten aus: Vor einem anderen Spieler
einen Klang erzeugen, nach einem anderen Spieler einen Klang erzeugen oder
mit einem anderen Spieler einen Klang erzeugen. Wieder horchen, bevor eine
andere Möglichkeit gewählt wird. Während der gesamten Dauer
des Stücks sollen die Möglichkeiten frei gewählt werden. Das
Stück endet, wenn alle wieder auf ein gemeinsames Horchen zurückkommen.
Bei einer Soloaufführung werden die Mitspieler durch Geräusche der
Umgebung ersetzt.“
Um Three Strategic Options aufführen zu können, müssen
alle Mitspieler auf inander hören. Bei jeder Wahlmöglichkeit verlagert
sich die Aufmerksamkeit. Die Erzeugung von Klängen vor anderen Mitspielern
kann in einen Wettbewerb ausarten. Man muß auf einen stillen Moment
hören, in dem sich eine Gelegenheit bietet. Zur Erzeugung von Klängen
nach anderen gehört Geduld. Man muß auf das Ende eines Klanges
hören. Das Erzeugen von Klängen gemeinsam mit anderen verlangt Intuition,
das unmittelbare Erkennen, wann man anzufangen und wann man aufzuhören
hat. Eine endgültige Aufführung wird nicht erwartet, da jede Aufführung
sich beträchtlich von einer anderen unterscheiden kann, obwohl die Vorgaben
unangetastet bleiben und man das Stück wiedererkennen kann, wenn es immer
von der gleichen Gruppe aufgeführt wird. Der Stil ändert sich hingegen
je nach Spielern, Instrumentation und Umgebung.
Zuallererst geht es in meinen schriftlichen und mündlichen Anweisungen
darum, den Spielern Aufmerksamkeitsstrategien an die Hand zu geben. Aufmerksamkeitsstrategien
sind nichts anderes als Hör- und Reaktionsweisen im Hinblick auf die
eigene Person, andere und die Umgebung. Diese Strategien führen zum Zuhören.
Hören die Musiker zu, dann lauscht wahrscheinlich auch das Publikum.
Obwohl es im Vergleich zu gewöhnlichen Partituren unmöglich scheint,
das Ergebnis einer Aufführung im voraus einschätzen zu können,
ist die Komposition der Anweisungen und des äußeren Rahmens ein
Handwerk, das genausoviel sorgfältige Überlegung erfordert wie jede
Partitur. Es ist wichtig, daß alle die allgemeinen Anweisungen verstehen.
Und diese Anweisungen allen klar zu machen, stellt für den Komponisten
eine Herausforderung dar. Ein falsches Wort kann Widerstände oder Verwirrung
hervorrufen. In der Werkreihe Interaktive Musik habe ich die Verantwortung
von Komponist, Ausführenden und Zuhörern neu verteilt, indem alle
schöpferisch am Hörprozeß, der einen Zugang zur Kreativität
eröffnet, teilhaben können.
Bei der Realisierung meiner Notation stellen viele Musiker und Zuhörer
fest, daß sie mit Phantasie zur Musik beitragen können. Darüber
hinaus kann sie Musikern auch beim Spiel konventionellerer Musik helfen.
Die Entscheidung, wie man Musik oder dem Alltagsleben zuhört, beeinflußt
die Qualität unserer Erfahrung. Das Hören ist ein Vorgang. Es kann
wie ein Blitzschlag urplötzlich im Augenblick stattfinden oder sich aus
eher intuitiven Vermutungen und gedankenvollen Anlehnungen an alte Erfahrungen
zusammensetzen. Das bloße Zuhören kennt weder Vergangenheit noch
Zukunft. Es hat die Macht, den Hörer möglicherweise für immer
zu verändern – die Wurzeln des Augenblicks.
Niemand von uns Komponisten oder Improvisierenden kann für sich beanspruchen,
Musik erfunden zu haben. Musik ist eine Gabe des Universums. Diejenigen unter
uns, die sich darauf einstimmen können, sind wahrhaft glücklich.
Wir haben mit einer mächtigen Kraft zu tun und nehmen zusammen mit Billiarden
von Musikern, die vor uns gekommen sind, unsere Zeitgenossen sind oder auf
uns folgen werden, an ihr teil. Wir können anderen dabei helfen, hören
zu lernen und durch das Hören als lebenslange Übung an diesem Prozeß
mitzuwirken. Als Musiker hören wir, um Tonhöhe, Klangfarbe und Rhythmus
immer weiter differenzieren zu können. Diese allerfeinsten Nuancen kommen
zusammen und schärfen das ästhetische Empfinden. Wenn wir zudem
immer mehr auf das hören, was Hintergrundgeräusch zu sein scheint,
erkennen wir Raumverhältnisse. Jeder Klang, auch das sogenannte Hintergrundrauschen,
ist Träger von Informationen und Beziehungen. Das gilt auch für
unser Alltagsleben. So lautet eine meiner Übungen: Man höre auf
alles, bis alles zusammengehört und man selbst Teil davon ist.
Viele Jahre lang habe ich Gruppen zu einem interaktiven, klangorientierten
Musizieren in Gruppen angeleitet. Überall scheinen Menschen ein Bedürfnis
zu haben, nonverbale Klänge zu erzeugen. Es geschieht meist tagtäglich
unbewußt, aber kaum einmal bewußt und in Gruppen. Nonverbale Klangerzeugung
ist eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und das Unbekannte
zu erforschen. Fast alle Teilnehmer spüren eine Art Loslassen, das sich
auch auf andere Aktivitäten auswirkt und die Phantasie fördert oder
den Geist einfach erfrischt. Ungehemmte Klangerzeugung mit der Stimme macht
Spaß. Musikalische Ausbildung wird nicht gebraucht – eine musikalische
Erfahrung aber kann und wird sich einstellen. [...]
Aus: MusikTexte – Zeitschrift für neue Musik, Heft 76/77, Dezember 1998
Pauline Oliveros
Die 1932 in Houston, Texas geborene
Komponistin Pauline Oliveros entwickelte das Konzept „Deep Listening“,
eine Ästhetik, die auf den Prinzipien Improvisation, elektronische Musik,
Ritual und Meditation basiert und sowohl Laien als auch professionelle Musiker
zur Kunst des Lauschens und des Reagierens auf Umweltklänge inspirieren
möchte. Oliveros erhielt eine erste musikalische Ausbildung am Klavier
und am Akkordeon von ihrer Mutter und ihrer Großmutter und wurde insbesondere
durch die Klänge der Natur beeinflußt: „Was mich am meisten
geprägt hat, ist mein frühkindliches Interesse für Klänge.
Wir lebten auf dem Land, wo die Luft tropisch schwül und voller Insekten
war. Ich erinnere mich an das Gewieher der Pferde, das Gemuhe der Kühe,
den Gesang der Hühner ... Ich könnte der Stereophonie der Autos,
dem Starter-Rasseln, Motorstottern, Türquietschen und ‚blllaps‘
ewig zuhören. Es ist fast wie Debussy, nicht wie der Wagnersche Bulldozer.
– Mein Stuhl knarrt, während die Unruhe wächst. Ich möchte
wissen, was Gottes Stuhl für einen Klang hat. Ich würde gerne verstärken,
wie eine Spinne ihr Netz webt.“
Sie studierte Komposition und Horn am San Francisco State College und spielte
in einer Improvisationsgruppe gemeinsam mit Terry Riley. In den sechziger
Jahren Kompositionen vorwiegend elektronischer Musik. „Als ich 16 war
lehrte mich mein Lehrer, Kombinationstöne zu hören. Das Akkordeon
eignet sich hervorragend dazu, sie zu erzeugen, wenn man es kräftig genug
quetscht. Von dieser Zeit an suchte ich nach einem Weg, die Grundtöne
zu eliminieren, so daß ich nur die Kombinationstöne hören
konnte. Als ich 32 war, nahm ich Signalgeneratoren oberhalb der Hörgrenze
und machte elektronische Musik mit den verstärkten Kombinationstönen.
Ich fühlte mich wie eine Hexe, die Klänge aus niederen Gefilden
einfängt.“ 1967 bis 81 Professur an der University of California
in San Diego. 1985 Gründung der „Pauline Oliveros Foundation“.
Weltweite Konzert- und Lehrtätigkeit.
Seit 1970 notiert die Komponistin im wesentlichen nur noch verbale Konzepte,
exemplarisch dafür die Reihe Deep Listening. „Es war ein allmählicher
Wandel. Ich hatte lange Zeit viel improvisiert, und nach und nach veränderte
sich die Improvisation in Meditation. Ich begann, lange Töne zu spielen
und zu singen, wollte sie nur am Klingen erhalten. Ich entdeckte, daß
das auf mich wirkte. Es änderte mich. Je länger ich einen Klang
spielte, desto mehr wirkte er sich auf die Veränderung meiner Wahrnehmung
aus. Das war also eine Eingebung: Versuche nicht, den Klang zu ändern,
laß den Klang sich ändern.“
Zur Site von Pauline Oliveros: http://www.deeplistening.org
Daniel Ott: zwischen

Daniel Ott: zwischen (Probenphoto)
„zwischen“ entstand 1997/98 mit dem und für das Ensemble Zwischentöne. Die Mitglieder des Ensembles gehen neben ihrer Interpreten-Tätigkeit auch noch anderen Berufen nach – als Arzt, KomponistIn, Geigenbauer, Tonmeister usw. Für diesen Standort zwischen verschiedenen Tätigkeiten und Bereichen haben wir gemeinsam für jede einzelne Figur Klänge und Bilder gesucht. „zwischen“ setzt sich aus den so gefundenen Klangbildern zusammen und bewegt sich auch zwischen Improvisation und Komposition: Die Klangportraits bzw. Klang-Umgebungen der einzelnen Spieler wurden teilweise von diesen selbst komponiert bzw. improvisiert. Die komponierten Teile des Stücks basieren zum Teil auf kurzen Texten, um die ich die Spieler gebeten hatte:
„ich schreibe.
ich schreibe, dass ich schreibe.
in meiner erinnerung höre ich mich schreiben,
höre mich antworten: ellen fricke, sprecherin und linguistin.
ich sitze an meiner alten reiseschreibmaschine
„torpedo“. ich höre ellen schreiben und sprechen.
ich tippe in die maschine was ich höre und antworte um in einen dialog
mit der sprechenden zu treten.
ein rhythmus entsteht.
ich tanze also. ich bis zum umfallen.
liegenbleiben. nichts.
schuhcremedosengeklapper ringsum. bin ich.
nichts ringsum tanzt, fällt um, liegt still da.
. . . dann vereinzelt ein helles geräusch wie von einem zu
boden geworfenen/gegangenen blechernen etwas – nicht mehr ich.
– ich werde wach, wenn ich
etwas höre, was durch bewegte Luft hörbar wird
– atem trifft auf widerstand: sprache, gesang, flötentöne,
der wind im kamin oder in den blättern
– holz: gewachsen, verzweigt, biegsam, entflammbar (. . . wie ich . .
.)
zwischen baustelle und musik. beim
mischen des mörtels kommt es auf die richtige mischung an.
der ins mörtelbett gesetzte stein wird mit dem mauerhammer nachgerichtet.
ist der stein zu gross,
wird er gespalten. die töne der bodenplatten ergeben eine skala.
1) det jefühl man kann nüscht
machen
2) dem pianeur ist nicht's zu schwör
3) musikmachen hat seine zeit und arbeiten hat seine zeit
messen des wertes mit der titration von gelb nach violett im glaskolben. langer klang die tiefe in sich ergründend nach aussen zeigend. unruhe rhythmisch schlagend an der melodie sich erfreuend.
bandoneonspielen und geigenbauen haben viel gemeinsames: über viele jahre hinweg kommen die bemühungen einem stochern im nebel gleich, das scheinbar wahllos einen zufälligen erfolg im finden der hütte verzeichnet. vor allem kommt es darauf an, nicht die orientierung zu verlieren.“
Ensemble Zwischentöne und Daniel Ott, Mai 1998
Zur Site von Daniel Ott: http://www.timescraper.de/komponisten/daniel_ott.html
Harry Partch: Lyrics by Li Po
Die Seventeen Lyrics
by Li Po stellen die erste erhaltene Komposition von Harry Partch dar. 1942
schrieb Partch über diesen Zyklus:
„The six lyrics of Li Po are set to music in the manner of the most ancient
of cultured musical forms. In this art the vitality of spoken inflections
is retained in the music, eyery syllable and inflection of the spoken expression
being harmoized by the accompanying instrument. The musical accompaniment,
or, more properly, complement, in addition to being a harmonization, is an
enhancement of the text-mood and frequently a musical elaboration of ideas
expressed.
The 300 years of the T´ang dynasty produced China´s finest lyric
poets. Li Po (701–762), born in eastern Shantung province, is considered
by many scholars as the foremost of these „Golden Age“ poets. At
about middle life Li Po was placed under imperial patronage, but at court
he incurred the displeasure of Yang Kuei-fei, one of China´s famous
beauties, and was banished to the Southern and Eastern provinces. It was after
he learned of his impending exile that he had the dream which he recounts
in his long poem so titled.
The first few lines of A Dream are purely introductory, the dream itself beginning
with the line, The moon in the lake followed my flight ... His awakening,
and the passing of the dream, Li Po compares to the waters of the river. The
rivers of China, all bearing in a general eastern direction, have so capriciously
held the power of life and death over the people that they quite naturally
become symbols of human existence. As the dream vanishes, so must all pleasures
of life: All things pass with the east-flowing water. Whatever parallels or
analogies are obvious to the Chinese mind in the extravagant fantasies of
the dream, to any hearer the fantasies serve to emphasize the reality of the
awakening, the iminent exile, and the final lines: How can I stoop obsequiously
and serve the mighty ones? It stifles my soul.
The 43-tone-to-the-octave system developed by Harry Partch is eminently appropriate
to the subtle intonations that inhere in Li Po lyrics. In The Night of Sorrow
the Adapted Viola anticipates each line of the lyric in the exact inflection
pattern of the spoken words as Partch had interpreted them.“

Rainer Killius und Marc Sabat
|
Die Adapted Viola Die „Adapted
Viola“, adaptiert an die von Harry Partch entwickelten „Monophonie-Prinzipien“,
unterscheidet sich von der gewöhnlichen Viola in folgenden Punkten:
Rechts: Schematische Darstellung des Griffbretts der Adapted Viola
Harry Partch 1901–1974.
1925 erstes Streichquartett in „Just Intonation“. 1927 Entwicklung
der „Monophonic Principles“. Seit 1929 Bau von Instrumenten
in neuen Stimmungen (Adapted Viola, Chromelodeon, Kithara, Chromatic
Organ u. a.). 1934 Forschungsarbeiten am British Museum. 1935–43
als Hobo auf den Straßen Amerikas. 1949 Publikation des Buches
„Genesis of a Music“. Ab 1960 rituelle Dramen und Opern. |
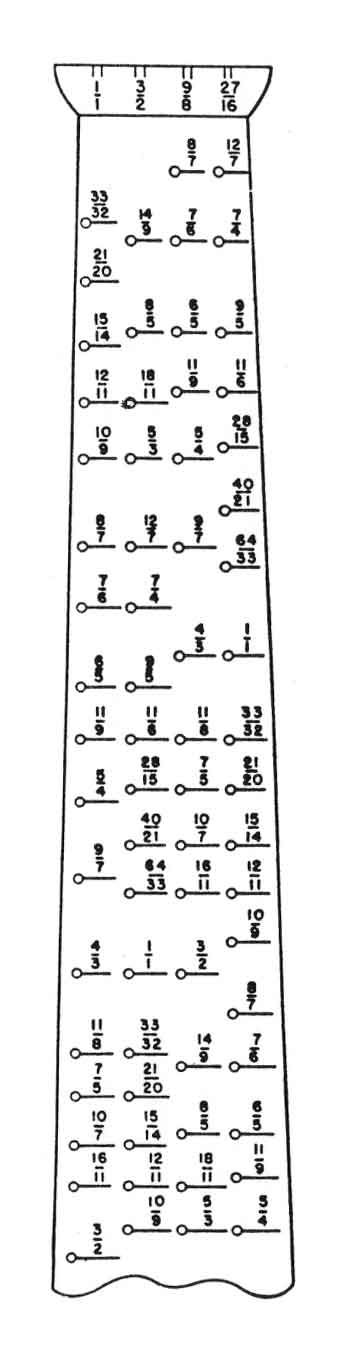 |
Michael Pisaro: the collection
about his composition michael pisaro says: "the collection began as some very small ideas that i didn't know how to handle. they seemed perhaps too small to be pieces. is two notes a piece? is a scale? a gesture? ultimately, the decision as to whether the idea was a piece (a process that might take hours or months) was whether the idea was 'something.' so this is a collection of 'somethings,' like things found one day walking in the city or on the beach."
Michael Pisaro
michael pisaro was born in 1961 in buffalo. he studied with george flynn, ben johnston and alan stout. residences took him to the mishkenot sha'ananim (israel), and the birch creek music center (wisconsin). from 1987 to 2000 he was teaching at the northwestern university evanston (illinois). in 1996 michael pisaro was a guest-lecturer at 'eartalk' in lesbos (greece). his work is frequently performed in the us and and in europe, in music festivals and in many smaller venues. it has been selected twice by the iscm jury for performance at world music days festivals (copenhagen, 1996, and manchester, 1998. in 1997/98 he was an artist-in-residence at the künstlerhof schreyahn (germany). since 2000 he is teaching at the california institute of the arts. he is a composer and guitarist, and member of the wandelweiser composers ensemble.
Zur Site von Michael Pisaro: http://www.timescraper.de/komponisten/michael_pisaro.html
Natalia Pschenitschnikowa: Mumu
„Mumu“ ist ein Stück nach der gleichnamigen Novelle des russischen Schriftstellers Iwan Turgenjew. Geschrieben habe ich es für das Ensemble Zwischentöne, und es wurde von jedem Ensemblemitglied inspiriert. Sein Konzept ist die Konfrontation „ewiger“ literarischer Motive mit dem Klangpotential des Ensembles. Ich habe mit jeder Musikerin und jedem Musiker nach ganz spezifischen Klangfaktoren geforscht, die mit physischen und psychischen Störprozessen verbunden sind. So entstand die „Vertonung“ dieser wunderschönen musikalischen Prosa. Den folgenden Abschnitt der Novelle habe ich dem Alt auf Russisch und dem Tenor auf Deutsch zum Erzählen gegeben:
„Eine Stunde nach diesen Vorfällen
ging die Tür des Kämmerchens auf, und Gerassim zeigte sich. Er hatte
seinen Festtagsrock an und führte Mumu an der Leine. Jeroschka trat zur
Seite und ließ ihn vorbeigehen. Gerassim lenkte seine Schritte zum Tor.
Die Bengel und alle, die auf dem Hofe waren, folgten ihm schweigend mit ihren
Blicken. Er kehrte sich nicht einmal um, seine Mütze setzte er erst auf
der Straße auf. Gawrilo schickte ihm ebendenselben Jeroschka als Beobachter
hinterher. Jeroschka sah von fern, wie er mit seinem Hund in einem Wirtshaus
verschwand, und wartete, bis er wieder heraustrat. Im Wirtshaus kannte man
Gerassim und kannte seine Zeichen. Er bestellte Kohlsuppe mit Fleisch und
setzte sich, wobei er sich mit den Armen auf den Tisch stütze. Mumu stand
bei seinem Stuhl und blickte ihn still mit ihren kleinen klugen Augen an.
Ihr Fell glänzte schön, woran man erkennen konnte, daß sie
eben erst gekämmt worden war. Man brachte Gerassim die Kohlsuppe. Er
brockte Brot hinein, schnitt das Fleisch klein und stellte den Teller auf
den Boden. Mit gewohnter Artigkeit, die Suppe kaum mit ihrer Schnauze berührend,
machte sich Mumu ans Fressen. Gerassim schaute ihr lange zu; zwei dicke Tränen
rollten plötzlich aus seinen Augen: die eine tropfte auf das steile Stirnchen
des Hundes, die andere in die Kohlsuppe. Er bedeckte sein Gesicht mit der
Hand. Mumu leerte den Teller zur Hälfte und wandte sich, das Maul leckend,
zur Seite. Gerassim erhob sich, zahlte die Suppe und ging, begleitet von dem
etwas erstaunten Blick des Kellners, hinaus. Als Jeroschka Gerassim erblickte,
sprang er schleunigst hinter eine Ecke, ließ ihn vorbeigehen und folgte
ihm wieder.
Gerassim ging ohne Eile seines Wegs, Mumu ließ er dabei nicht von der
Leine. An einer Ecke der Straße verharrte er wie unentschlossen, und
auf einmal eilte er mit großen Schritten direkt der Krimfurt zu. Unterwegs
schwenkte er in den Hof eines Hauses ein, an dem gerade ein Seitenflügel
angebaut wurde, und holte sich von da zwei Ziegelsteine, die er unter dem
Arm trug. Von der Krimfurt wandte er sich zum Flußufer, das er bis zu
einer Stelle entlangging, wo zwei kleine Ruderboote an Pflöcken angebunden
waren – er hatte sie schon früher bemerkt –, er sprang in eins
von ihnen und Mumu tat das gleiche. Irgendein lahmer Alter kam aus der Hütte
hervor, die in der Ecke eines Gemüsegartens stand und schrie ihn an.
Gerassim aber nickte nur mit dem Kopf und legte sich so mächtig in die
Riemen, daß er, obgleich er gegen die Strömung des Flusses ruderte,
im Handumdrehn an die hundert Klafter zurückgelegt hatte. Der Alte stand
noch lange da, kratzte sich dann den Rücken zuerst mit der linken, dann
mit der rechten Hand und kehrte schließlich hinkend in seine Hütte
zurück.
Gerassim aber ruderte und ruderte. Schon hatte er Moskau hinter sich gelassen.
Schon erstreckten sich längs der Ufer Wiesen, Gemüsegärten,
Felder und Wälder; Bauernhütten lagen verstreut. Landluft wehte
ihm entgegegn. Er ließ die Ruder fahren, drückte seinen Kopf an
Mumu, die vor ihm auf einem trockenen Sitzbrett saß – der Boden
war mit Wasser bedeckt –, und verharrte reglos, die mächtigen Arme
über ihrem Rücken verschränkt, während die Fluten den
Kahn sacht zur Stadt zurücktrugen. Schließlich richtete sich Gerassim
auf, wand hastig, mit schmerzzerquältem, bitteren Gesichtsausdruck einen
Strick um die mitgenommenen Ziegelsteine, legte eine Schlinge, streifte sie
Mumu um den Hals, hielt sie über die Fluten und blickte sie ein letztes
Mal an ... Zutraulich und ohne Furcht sah sie ihn an und wedelte leise mit
dem Schwänzchen. Er wandte sich ab, schloß die Augen und löste
die Hände ... Gerassim hatte nichts gehört, weder das kurze Aufwinseln
Mumus beim Fall noch das schwere Klatschen des Wassers; für ihn war selbst
der lärmende Tag so still und stumm wie für uns nicht einmal die
stillste Nacht, und als er die Augen wieder auftat, spielten auf dem Flusse
wie zuvor die kleinen Wellen, die einander nachzujagen schienen; wie zuvor
plätscherten sie und pochten an die Planken des Bootes, und nur fern
dahinten, dem Ufer zu, verloren sich die letzten weiten Ringe.“
Natalia Pschenitschnikowa, in: Klangwerkstatt 2000 – Neue Musik in Kreuzberg, Programmheft November 2000

Natalia Pschnenitschnikowa: Mumu
Natalia Pschenitschnikowa
Natalia Pschenitschnikowa wurde
in Moskau geboren. Dort absolvierte sie zunächst die Zentrale Musikschule
und dann das Tschaikowskij-Konservatorium. Danach arbeitete sie als Solistin
und widmete sich insbesondere der Barockmusik auf historischen Instrumenten
sowie der zeitgenössischen Musik und Improvisation.
Sie spielte auf verschiedenen internationalen Festivals, u. a. Moskauer Herbst,
Huddersfield-Festival, Internationales Flötenfestival Helsinki, Alternativa
Moskau, Berliner Festspiele, Kammermusikfest Lockenhaus, Aterforum Ferrara,
Inventionen Berlin. Neben ihrer klassischen Konzerttätigkeit nimmt sie
teil an multimedialen Performances (mit Alexej Sagerer, Dmitrij Prigow, German
Winogradow, Christian Marclay, Peter Machjdik u. a.). Im Performance-Bereich
realisiert sie außerdem unterschiedliche Soloprojekte. In den letzten
Jahren hat sie sich als Vokalistin im experimentellen Bereich einen Namen
gemacht. Außerdem ist sie Autorin verschiedenen Klangaktionen, konzeptueller
Kompositionen und von Film- und Theatermusik.
Sie brachte mehrere für sie geschriebene Kompositionen zur Uraufführung,
u. a. von Gija Kancheli, Johannes Fritsch, Daniel Matej, Bernhard Lang, Anna
Ikramowa, Nic Collins, Peter Ablinger, Klaus Lang, Sergej Newski, Vadim Karassikov
und arbeitete mit so unterschiedlichen Musikern wie Alexej Ljubimow, David
Moss, Elsbeth Moser und Wladimir Tarassow zusammen. Von ihr liegen Schallplatten-
und CD-Aufnahmen der Firmen Melodija, Art & Electronica, Col Legno und
ECM Records vor.
Zur Site von Natalia Pschenitschnikowa: http://web-boettcher.uni-paderborn.de/natalia/natalians.htm
gerhard rühm: abhandlung über das weltall
der „abhandlung über
das weltall“ liegt ein wissenschaftlicher vortrag über das weltall
zugrunde, der in zunehmendem masse verschiedenen manipulationen unterworfen
wird, bis er sich schliesslich von einem sachlich beschreibenden in einen
ästhetischen text verwandelt hat, zu einem autonomen hörereignis
wird.
der statistischen häufigkeit der phoneme entsprechend, saugen die häufigeren
sukzessiv die selteneren auf, bis mit dem übrigbleibenden „e“
(dem häufigsten laut der deutschen sprache) die maximale entropie erreicht
ist. die sprache ist, gemäss der voraussichtlichen entwicklung des weltalls,
gleichsam den wärmetod gestorben. nach massgabe der wachsender entfernungen
im universum emanzipiert sich der text zunehmend von der blossen beschreibung,
wird also immer unverständlicher und zugleich elementarer. die lautgebilde
werden bis zur unkenntlichkeit deformiert, verlieren schliesslich jeglichen
bedeutungsgehalt und präsentieren sich als eigenständige phänomene
jenseits der semantik.
eine weitere manipulation betrifft die raum-zeit-beziehung. ebenfalls dem
weltall adäquat, dehnt sich der text aus, zerstäubt (nach einem
prädeterminierten prinzip), die distanzen zwischen den auseinanderstrebenden
elementen vergrössern sich kontinuierlich, die einzelnen elemente werden
immer „einsamer“.
der unaufhaltsamen nivellierung und verflüchtigung wirkt jedoch, gleichsam
als emotionale reaktion, die artikulation der menschlichen stimme entgegen:
eine differenzierung der dynamik und des ausdrucks vom normalen sprechton
bis zum flüstern und schreien.
gerhard rühm (2002), in: Physiognomien des Lautens, Programmheft, Juni 2002
Das gespreizte „e“
Es gehört zu den Verdiensten der Avantgarde, sich des in Genres und Formen sicher ausgeprägten Systems der Kunst nicht einfach zu bedienen, sondern dieses auf seine Möglichkeiten und Gesetzmäßigkeiten hin zu befragen. Diese Haltung unterscheidet die wenige avancierte Musik von der großen Masse der bloß neuen, oftmals nicht einmal zeitgenössischen. Den feinen Übergängen zwischen Musik und Sprache nachzugehen, unternimmt das Ensemble Zwischentöne in seiner dreiteiligen Konzertreihe „Physiognomien des Lautens“, die heute im Ballhaus Naunynstraße beginnt.
Gerhard Rühm, Altmeister der experimentellen Sprach- und Textkomposition und Mitbegründer der Wiener Gruppe, bahnt sich zu Beginn den Weg von der Sprache zur Musik. In seiner dreiviertelstündigen „Abhandlung über das Weltall“ (1964/66) verdrängen in einem populärwissenschaftlichen Vortrag die statistisch häufigeren Phoneme nach und nach die selteneren, bis schließlich das 28mal wiederholte, durch lange Pausen gespreizte „e“ übrigbleibt. So verwandelt sich Sprache zu klingendem Material. Den inneren Monolog der Opern-Arie nimmt Michael Hirsch in seiner 2. Studie zum „Konvolut, Vol. 2“ wörtlich als von den Darstellern stumm vollzogenen Text, aus dem nur einzelne Fragmente kurz herausplatzen. Peter Ablinger betrachtet in seinen knappen, heute uraufgeführten „Studien nach der Natur“ Alltagsgeräusche vom Autoverkehr bis zum Mückensummen, die sechs Sänger nach genau ausnotierter Partitur klanglich nachahmen. Zusammen mit Werken von Josef Anton Riedl und Harry Partch entsteht so ein abwechslungsreiches Kompendium avancierter Sprachbehandlung.
Volker Straebel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Seiten, 15. Juni 2002

gerhard rühm: abhandlung über das weltall
bemerkungen zur lautdichtung
die konsequente lautdichtung oder
„phonetische poesie“ ist die einzige wirklich internationale, das
heisst, keine übersetzung benötigende gattung der literatur wenn
auch in der artikulation des vortragenden noch spuren der typischen färbung
seiner muttersprache vernehmbar sind. selbst regionale unterschiede der aussprache
können sich noch bemerkbar machen (im deutschen etwa beim „r“
eines bayern und dem eines norddeutschen).
durch die freisetzung der phoneme aus dem geregelten wortverbund und damit
den verzicht auf semantik, verfügt die lautdichtung über einen nahezu
unbeschränkten vorrat nuanciertester lautelemente, die durch verwendung
mehrerer stimmen (simulteneität muss nicht mehr auf wortverständlichkeit
achten) sowie die nutzung technischer hilfsmittel polyphon verdichtet und
weiter differenziert werden können.
die meisten meiner lautgedichte, die nur für einen sprecher konzipiert
sind, beschränken sich auf noch erkennbare sprechlaute, sparen also darüber
hinausgehende mund- und körpergeräusche aus. so bleibt ein wenn
auch rudimentärer, gleichwohl emotional nachvollziehbarer sprechgestus
gewahrt. zudem kommt der spezifische ausdruckscharakter der verschiedenen
laute, der normalerweise durch ihre dienende rolle als bedeutungsträger
verblasst, wieder in seiner ursprünglichen präsenz unmittelbar zur
geltung.
im interesse einer klaren terminologie sollte innerhalb der zum vortrag, zum
hören bestimmten „auditiven poesie“ grundsätzlich unterschieden
werden zwischen klanggedichten („sound poetry“), die ausdrücklich
dem rhythmischen klangkörper des gesprochenen wortes verpflichtet sind,
und lautgedichten („phonetic poetry“), deren kompositionsmaterial
der einzellaut mit seinen nun allseitig offenen kombinationsmöglichkeiten
ist.
wie die ungegenständliche bildnerei einen eigenständigen bereich
innerhalb der bildenden kunst repräsentiert, so die lautdichtung als
asemantische poesie in der dichtung. da wie dort sind, auf der gemeinsamen
basis allgemein verbindlicher physiognomik, mannigfaltige zwischen- und mischformen
denkbar.
das visuelle pendant zur „phonetischen poesie“ ist in der optisch
orientierten „visuellen poesie“ die „typografische poesie“
als rigorose reduktion auf buchstabenformen – von der handschrift bis
zur druckschrift.
gerhard rühm
gerhard rühm: zeitung – stets aktuelles simultanstück (kurt schwertsik gewidmet)
die jeweils aktuelle tageszeitung wird in gleich grosse teile (etwa postkartenformat) gerissen und an die ausführenden (mindestens vier) verteilt. jeder notiert, nachdem er die vorder- oder rückseite gewählt hat, in der ecke des blattes fortlaufend (siehe unten) die wartezeit zu seinem (lese)einsatz und die lautstärke. sodann werden die blätter gemischt. nach dem startzeichen zählt jeder stumm die wartezeit seines erten blattes ab, liest dan den text von beginn an (auch wenn er auf ein wortfragment fällt) in der angegebenen lautstärke vor und lässt es nach dem ersten erscheinen des wortes „und“ (dieses wird noch mitgesprochen) fallen. darauf wird mit dem nächsten und allen weiteren blättern ebenso verfahren. normales sprechtempo.
wartezeiten: 5 sec., 10 sec., 15 sec., 20 sec., 30 sec., 50 sec. lautstärken: geflüstert (pp), leise (p), normal (mf), laut (f), geschrien (ff).
gerhard rühm, 1962

gerhard rühm: zeitung (Probenphoto)
Gerhard Rühm
Gerhard Rühm, geboren 1930
in Wien, studierte Klavier und Komposition an der Wiener Musikakademie, danach
privat bei Josef Matthias Hauer, und beschäftigte sich während eines
längeren Aufenthalts im Libanon mit orientalischer Musik. Mitte der fünfziger
Jahre war er Mitbegründer der „Wiener Gruppe“ (Achleitner,
Artmann, Bayer, Rühm, Wiener), der 1997 eine grosse Retrospektive in
der „Biennale di Venezia“ ausgerichtet wurde. Rühm wurde zuerst
durch Buchveröffentlichungen experimenteller Poesie bekannt. Von Anfang
an aber intermedial orientiert, entwickelte er Dichtung vor allem in Grenzbereichen
weiter – sowohl zur bildenden Kunst (visuelle Poesie, gestische und konzeptionelle
Zeichnungen, Fotomontagen, Buchobjekte) als auch zur Musik (auditive Poesie
als Sprech- und Tonbandtexte, Chansons, Melodramen, Vokalensembles, Ton-Dichtungen).
Sein Wirkungsbereich umfasst literarische, musikalische und bildnerische Publikationen
(u. a. bei Rowohlt, Luchterhand, Hanser, Residenz, Haymon), Vorträge,
Konzerte, Ausstellungen, Theateraufführungen und Rundfunkproduktionen
(wichtige Beiträge zum „Neuen Hörspiel“, Karl-Sczuka-Preis
1977, Hörspielpreis der Kriegsblinden 1983). Österreichischer Würdigungspreis
für Literatur 1976, Preis der Stadt Wien 1984, Grosser Österreichischer
Staatspreis 1991. Umfassende Präsentation seiner Arbeit beim Steirischen
Herbst Graz 2001.
Rühm lehrte 1972-1995 als Professor an der Staatlichen Hochschule für
Bildende Künste in Hamburg sowie mehrmals an der Internationalen Sommerakademie
für Bildende Kunst in Salzburg.
Klavierstücke, Lieder und Melodramen erschienen im Thürmchen Verlag
Köln und in der ORF-Edition Zeitton, Hörspiele auf CD bei Wergo.
Anfang Ensemble Aktuelles Repertoire Pressestimmen Photos Kontakt